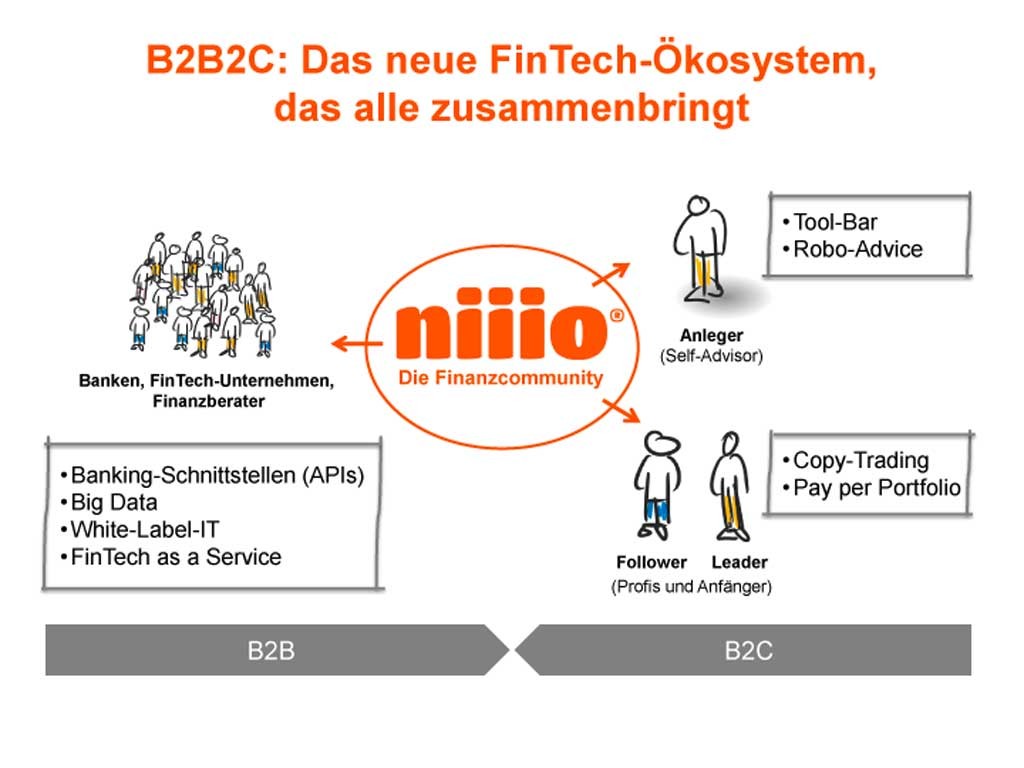Wo digitale und physische Welten aufeinandertreffen
Gastbeitrag von Jim Heppelmann, CEO und President von PTC
Die digitale Technologie formt unsere Welt und bestimmt unser Tun und Denken seit Jahrzehnten – sie prägt die Art, wie wir mit unseren Mitmenschen kommunizieren, wie wir Dinge und Ideen umsetzen. Und mehr noch, inzwischen vermischt sich die digitale Welt mit der Welt der physischen Dinge in einer Weise, die nicht nur unseren Alltag verändert, sondern ganze Wirtschaftsmodelle beeinflusst.
Das Internet der Dinge (IoT ) verbindet Alltagsgegenständen, von Fahrrad und Kühlschrank bis hin zu Stromerzeugern, mit der Cloud. Dies bietet Entwicklern, Herstellern und Dienstleistungsunternehmen Echtzeit-Feedback über die Performance ihrer Produkte sowie Leistungen und ermöglicht eine optimierte Konzeption und Weiterentwicklung. Neue Geschäftsfelder rücken damit in nahe Zukunft.
Produkte erweitern und dem Markt anpassen
PTC investiert in das Geschäft der „Dinge“ seit mehr als drei Jahrzehnten und bietet Unternehmen zukunftsweisende Technologien, wie beispielsweise Computer-Aided Design (CAD), die heutzutage aus der Forschung, dem Prototyping und der Produktentwicklung in vielen Branchen nicht mehr wegzudenken sind. Allein in den vergangenen drei Jahren hat PTC mehr als 500 Millionen Dollar investiert, um die Konvergenz der physikalisch-digitalen Welt voranzubringen. Unter der Konzernmarke ThingWorx hat PTC eine Reihe von Startups und Technologien erworben, einschließlich der Vernetzungsexperten Axeda und ColdLight. Letztere sind auf automatisierte, vorausschauende Analysen spezialisiert, die auf Feedback der Produkte basieren und auf die entsprechende Kundenberatung.
Um die Kunden dabei zu unterstützen, intelligente und vernetzte Produkte auf den Markt bringen zu können, hat PTC seine bekannten CAD- und PLM-Lösungen Creo und Windchill um spezielle Werkzeuge zur IOT-Entwicklung erweitert. Kernstück des IoT-Technologie-Portfolios ist heute die ThingWorx-Plattform, die Module zur Konnektivität, Geräte-Clouds, Geschäftslogik, Big Data, Analysen und Remote-Service-Anwendungen integriert.
Prototypen ohne Performance-Feedback
In der Produktentwicklung beginnt fast alles mit einem 3D-Modul. Mit aktuellster CAD-Software lassen sich Ideen vorab validieren und digitale Prototypen einfach erstellen. Ist der Prototyp einmal in der Fabrik angekommen und rollen die Produkte erfolgreich vom Band endet das Produktzyklusmanagement genau an diesem Punkt. Informationen über die Geräte und deren Performance gelangen meist nicht zurück in die digitale Welt, in der das Produkt einmal entworfen wurde. Auch heutzutage werden immer noch viele Produkte ohne Feedback-Schleife entwickelt. So bleibt den Herstellern meist nichts anderes übrig, als auf gute Performance der Produkte und positives Feedback der Kunden zu hoffen. Entspricht das Produkt nicht den Erwartungen ist es oft bereits zu spät und das Image des Unternehmens dank sozialer Netzwerke schnell geschädigt.
Intelligente Geräte werden vernetzt
Diese einseitige Umsetzung von digitalem Know-How in physische Produkte steht nun vor dem Aus. Einer aktuellen Studie von PTC in Zusammenarbeit mit Prof. Michael Porter der Harvard Business School zufolge hat die Ära der intelligenten Geräte bereits begonnen. Auch in unserem Alltag halten diese „smart devices“ Einzug. Beispiele finden sich in den neusten Autos mit integrierten Software-Anwendungen, die direkt in die Motorsteuerung eingreifen können. Aber auch viele Alltagsgegenstände können bereits ihren Wartungsstatus selbstständig überprüfen.
Der nächste Schritt ist nun die Vernetzung der intelligenten Geräte, um miteinander kommunizieren zu können und gegebenenfalls Daten miteinander auszutauschen. Werden diese Daten in der Cloud gespeichert können sie von jedem beliebigen Ort überwacht und von Computern, Smartphones und anderen Steuerelementen kontrolliert werden.
Zwei Welten verschmelzen zu neuer DNA
In der Cloud lassen sich ganze Produktfamilien mit ähnlichen Elementen zu einem neuen Ecosystem zusammenfassen. Sehr erfolgreich macht das Apple mit seiner Produktpalette: Alle Geräte wie iPad, iPhone oder iMac teilen sich in einer gemeinsamen Wolke die Dienste iCloud, iTunes und den App Store. Dies ist nur möglich, weil sie alle auf gemeinsame digitale Komponenten zurückgreifen.
Software-Anbieter wie PTC ermöglichen Herstellern derartige Ecosysteme zu schaffen, teils physisch, teils digital; Client- oder Server-basiert; vor Ort oder in der Cloud stationiert. Die digitale und die physische Welt verschmelzen miteinander zu einer neuen DNA. Ob medizinische Produkte, Haushaltswaren oder Verkehrsmittel, die beiden Welten sind nicht mehr zu trennen und sie fungieren künftig als eine. Die Vielfalt ist grenzenlos – intelligente Städte, Fabriken und Infrastrukturen werden entstehen.
Ein Mountainbike, halb physisch halb digital
Vernetzte Produkte besitzen nun alle eine Stimme und die Möglichkeit Feedback zu geben. Sie kommunizieren und können Informationen über Performance, Design und Effizienz mit den Herstellern teilen. Diese Stimme ist unerlässlich und sollte Gehör finden. Ein Paradebeispiel kommt aus dem Radsport: Das Santa Cruz V10, ein Full-Carbon Mountainbike, das 2010 den Mountain Bike World Cup gewann. Das Rad wurde auf dem CAD-System Creo von PTC entwickelt und mit einem Raspberry Pi Computer ausgestattet. Das vernetzte Mountainbike konnte somit zahlreiche Charakteristiken wie Radgeschwindigkeit, Trittfrequenz und Federungseigenschaften aufzeichnen und weiterleiten. Es entstand ein Rad, das einen digitalen Zwilling bekam – also halb physisch halb digital existierte. Über tausende von Kilometern entfernt können nun die Produzenten anhand eines Dashboards den digitalen Zwilling nachverfolgen und somit sehen was mit dem „realen“ Mountainbike gerade passiert.
Das Ziel ist jedoch, dass die Informationen nicht nur in eine Richtung – wie am Beispiel des Mountainbikes, von der physischen in die digitale Welt – fließen. Vielmehr müssen Daten beidseitig getauscht werden können und Verwendung finden. Während das Fahrrad dem Computer Daten liefert, kann mittels Augmented Reality auch der Computer sozusagen dem Fahrrad direkt weiterhelfen. Scannt der Fahrradtechniker die Seriennummer des Rades mit seinem mobilen Endgeräte ab, so erhält er auf seinem Display alle wichtigen Daten als digitales Dashboard. Diese können über ein Bild des Fahrrads gelegt werden und zeigen damit alle wichtigen Servicepunkte direkt auf dem Bildschirm an. So kann der Servicemitarbeiter beispielsweise auf seinem Display auf die Bremsen klicken und bekommt angezeigt, wie der Abnutzungsgrad ist und wann ein Austausch der Bremsbelege sinnvoll ist.
Heutige Zukunft: Augmented Reality und Big Data in der Anwendung
Damit können Fehler und Schwachstellen am Gerät direkt vor Ort identifiziert werden. Animierte Simulationen, die direkt über das Bild des Produktes gelegt werden, zeigen Reparatur- und Wartungsschritte an. Solche Anwendungen mit Augmented Reality eignen sich auch für komplexere Gerätschaften wie Stromgeneratoren. Dadurch könnten umständliche schriftliche Dokumentationen ersetzt werden und eine Übersetzung in mehrere Sprachen würde dank grafischer Darstellung entfallen. Die Wartung wäre schneller und einfacher zu handhaben.
Synergien aus digitaler und physischer Welt sind unabdingbar. Holen Hersteller die Daten von Tausenden oder gar Millionen Einzelprodukten ein, so können Big Data Analysen diese Informationen auswerten und in den weiteren Prozess der Produktentwicklung miteinfließen lassen. So können Produktinnovationen vorangetrieben und der Service verbessert werden.
Das Internet der Dinge ist bereits in vollem Gange und es kündigt Visionen einer digitalen vernetzten Zukunft mit bahnbrechenden Geschäftsmodellen an. Verbraucher und Geschäftswelt werden gleichermaßen davon profitieren.
Weitere Informationen unter:
www.ptc.com