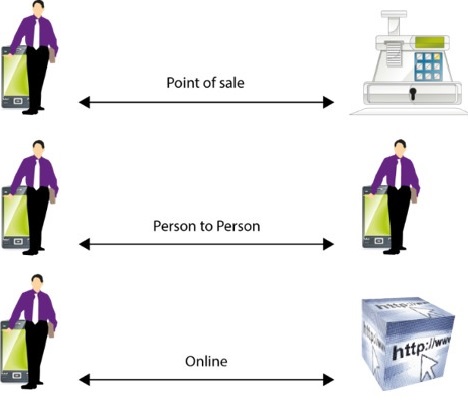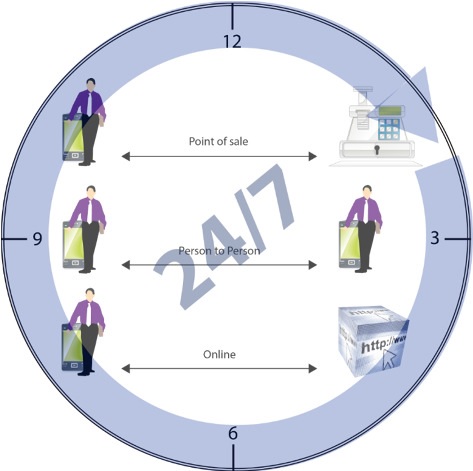Gastbeitrag von Ines Maione, Marketing Managerin, clickworker GmbH
Mit Crowdsourcing stark für den
internationalen Wettbewerb im Online-Handel
Einhergehend mit der stetig steigenden Netzgeschwindigkeit und dem immer breiter werdenden Angebot an bezahlbaren, technisch ausgefeilten Mobile Devices, steigt auch die Rate der Personen, die E-Commerce-Angebote nutzen. Lt. dem Statistikportal statista.com wird sich der weltweite Umsatz im E-Commerce dieses Jahr auf etwa 889.790,9 Mio. EUR belaufen. Der Prognose nach wird sich der Umsatz bis zum Jahr 2020 um weitere 50 % erhöhen und damit 1.334.864,6 Mio. EUR erreichen.
Die Aussichten für Online-Händler scheinen damit äußert positiv. Dennoch wird das Klima für einzelne Online-Händler immer rauer. Durch die zunehmende Internationalisierung und Konsolidierung im E-Commerce steigt auch der Wettbewerbsdruck. Neben einem unerbittlichen Preiskampf steigt dabei auch der Kampf um den besten Shop, mit der besten Technik, Usability, dem besten Service und dem höchsten Erlebnisfaktor für den Nutzer sowiedie Sichtbarkeit im Netz. Nur wer hier als Händler mithalten kann und dabei effizient vorgeht, wird mitwachsen können.
Eine Möglichkeit für Online-Händler, Projekte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durchzuführen und dabei äußerst effizient vorzugehen, ist der Einsatz von Crowdsourcing.
Crowdsourcing – Die Hilfe der Vielen
Beim Crowdsourcing werden Aufgaben und Projekte an eine große Anzahl Internetnutzer (die Crowd-Community) vergeben. Dieses Prinzip ist im Laufe der letzten 10 Jahre professionalisiert worden und hat zahlreiche Crowdsourcing-Serviceanbieter hervorgebracht. Die Anbieter unterscheiden sich neben der Spezialisierung auf bestimmte Aufgaben auch in der Methode der Auftragsabwicklung, im Service, in der geografischen Marktausrichtungsowie in der Zusammensetzung ihrer Crowd-Community.
Gerade bei der Umsetzung von Projekten im E-Commerce fallen häufig Hunderte oder auch Tausende von Aufgaben an, die einzeln gesehen zwar keinen großen Aufwand darstellen, in der benötigten Masse aber von Online-Händlern kaumeffizient zu bewältigen sind. Als Beispiel ist hier die Erstellung anspruchsvoller, einzigartiger Produktbeschreibungen zu nennen. Zur Bewältigung solcher Aufgaben bietet sich die Crowdsourcing-Methode „Microtasking“ an. Beim Microtasking werden größere Projekte in kleinere, gleichartige und in sich abgeschlossene Teilaufgaben (sog. Microtasks) zerlegt. Am Projektbeispiel der Erstellung von Produktbeschreibungen für einen kompletten Onlineshop entspricht die Erstellung einer Beschreibung einem Microtask. Die Microtasks werden auf der Online-Plattform des Crowdsourcing-Anbieters dem Teil der Crowd-Community zur Bearbeitung angezeigt, der hierfür nachweislich qualifiziert ist. Die Tasks werden von mehreren Teilnehmern der Community, sog. Clickworker, auf Honorarbasis und nach Anweisungen (Briefing) bearbeitet. Alle Ergebnisse werden abschließend über Qualitätsmanagement-Verfahren geprüft und erst dann dem Kunden übermittelt.
Die Qualifizierung der Clickworker wird bei den meisten Microtrasking-Anbietern über Online-Tests, gesicherte Profilangaben sowie über die kontinuierliche Bewertung der Arbeitsergebnisse sichergestellt.
Die Qualitätskontrolle der Ergebnisse ist abhängig von der Aufgabenart. Mögliche Verfahren sind: Plagiatskontrolle, einfaches oder doppeltes Lektorat, 4-Augen-Prinzip und Mehrheitsentscheide.
Über die Microtasking-Methode können sehr schnell viele hochwertige Ergebnisse eingeholt und auch große Projekte in kürzester Zeit abgeschlossen werden. Bei der Projektabwicklung via Microtasking stehen nicht nur Tausende von Helfern bei Bedarf zur Verfügung,sondern auch deren Knowhow (Sprachen, Fachkenntnisse, Ortskenntnisse, etc.), menschlicher Verstand und Sichtweisenals potenzielle Kunden. Das alles in Summe macht den Einsatz von Microtasking so effizient, zumal auch die Kosten für die Projektumsetzung im Verhältnis zu anderen möglichen Lösungen relativ gering sind.
Trends und Herausforderungen im Online-Handel mit Microtasking begegnen

„Wer international erfolgreich sein möchte, muss auch das Angebot seiner Konkurrenten in den Zielmärkten kennen und ihnen immer einen Schritt voraus sein.“ weiß Ines Maione, Marketing Managerin bei Clickworker.
Die Einsatzmöglichkeiten von Microtasking zur Steigerung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit im Online-Handel sind vielfältig. Anhand einiger aktuellerTrends und Herausforderungen im Online-Handelkönnen Beispiele aufgeführt werden, wie Microtasking hier bereits genutzt wird.
Content-Flut im Web und das Gerangel um die ersten Plätze bei Google & Co.
Mit dem zunehmenden Wettbewerb im Online-Handel steigt auch die Menge an Content im Netz. Das macht es für den Einzelnen vergleichsweise schwerer, mit dem eigenen Content sichtbar zu bleiben. Die ersten Plätze bei Suchmaschinen wie Google & Co. erhält der Content, der für das eingegebene Suchwort und für den Nutzer am relevantesten ist.
Über Microtasking lässt sich zeitnah zahlreicher Content in Form von Texten erstellen, die sowohl den Such- maschinen als auch den Nutzern gefallen. Des Weiteren kann über diese Methode jeglicher Content im Shop mit den wichtigsten Tags verschlagwortet und damit seine Auffindbarkeit im Netz weiter optimiert werden.
Texterstellung
Die von Online-Händlern über Microtasking am häufigsten beauftragten Texte sind Produktbeschreibungen, Kategoriebeschreibungen, Ratgeber, Glossare, Blogartikel, Herstellerinformationen, Fragen für die FAQ-Seite, News, sowieAnwendungs- bzw. Gebrauchsbeispiele.Entsprechend dem Briefing werden diese mit oder ohne Keywordssowie Zwischenüberschriften, in diversen Textlängen zeitnah,qualitativ hochwertig und selbstverständlich plagiatsfreierstellt.
Verschlagwortung / Tagging von Content
Zur besseren Auffindbarkeit von Content im Netz, aber auch innerhalb der Onlineshops selbst, lassen bereits diverse Online-Händler ihren Content via Microtasking sichten und mit passenden Begriffen verschlagworten. Darunter vor allem Content wie: Texte, PDFs, Videos, Bilder (hier vor allem Produktabbildungen), Online-Kataloge.
Abnehmende Kundenloyalität
Die Loyalität der Kunden gegenüber Online-Händlern nimmt stetig ab. Gekauft wird dort, wo es am billigsten ist oder aber das Shopping-Erlebnis am besten ist. Für die Online-Händler bedeutet das,dass sie ihren Fokus kompromisslos auf den Kunden ausrichten müssen. Angebote sollten übersichtlich sowie zielgruppenspezifisch gefiltert angezeigt und zahlreiche Such- und Filterfunktionen für den Kunden angeboten werden. Auch die Ausführlichkeit der Produktinformationen sowie die Darstellung der Produkte sind ausschlaggebend für die Entscheidung des Kunden für den Kauf und für den Shop.
Microtasking wird hier häufig eingesetzt, um die zahlreichen Daten die für Filter- und Suchfunktionen sowie die Produktdarstellung benötigt werden, zügig aufzubereiten und/oder zu digitalisieren. Aber auch zum Testen des Shops und desShoppingerlebnisses eignet sich der Einsatz von Microtasking sehr gut.
Produktkategorisierung und -Tagging
Diverse Online-Händler lassen ihre Produkte über Microtasking den ihrer Warentaxonomie entsprechenden Kategorien zuordnen. Auch das Zuordnen und Taggen der Produkte im Shop nach verschiedenen Produktmerkmalen ist üblich und sinnvoll. Nur mit Hilfe dieser Maßnahmen können Suchfunktionen und Facettenfilter funktionieren und über ein ‚Mehr‘ an produktspezifischen Tags verfeinert werden.
Produktdatenpflege
Mangelnde Produktdaten sind häufig der Grund dafür, dass der Kunde sich für einen Kauf noch nicht genügend über das Produkt informiert fühlt und den Shop wieder verlässt. Dem begegnen die Online-Händler mit einem ‚Mehr‘an Produktinformationen. Die Informationen werden über Microtasking bspw. aus Fotos oder PDFs auch zu Tausenden zeitnah extrahiert und in die CMS der Online-Händler eingespielt. Das ‚Mehr‘ an Produktinformationen reduziert nicht nur die Abbruch- sondern auch die Retourenrate. Zudem können die extrahierten Produktdaten als weitere Daten für Facettenfilter und Suchfunktionen eingesetzt werden.
Produktbild-Tagging
Zur verbesserten Darstellung der Produkte setzen Online-Händler vermehrt 360-Grad-Abbildungen ein, die je nach Kundenbedarf auch im Detail angesehen werden können. Zur Optimierung und Navigation der Bildansichten lassen sie häufig alle Produktansichten über Microtasking taggen. Z.B. Schuh von vorne, Schuh von hinten, Schuh von oben, Sohle, Detail Schuhspitze, etc.
Testing
Auch ob die Produktdarstellung und Navigation nutzerfreundlich ist, einwandfrei funktioniert und das auch auf Mobile Devices, kann über Microtasking getestet werden.
Globalisierung des E-Commerce
Die Internationalisierung steht für viele Online-Händler ganz oben auf der To-Do-Liste, wenn es um Wachstum und Expansiongeht. Das Potenzial an Kunden im Ausland abzuschöpfen kann sich, abhängig vom Onlineshopping-Verhalten der User, den Preisen im Zielmarkt sowie der anfallenden Versandkosten, lohnen.Wichtige Schritte zur Internationalisierung sind eine sorgfältige Marktanalyse und eine zielgruppenspezifischen Ansprache.
Microtasking ist hier sehr gut geeignet, um schnell Informationen zur Zielgruppe und zum Wettbewerb zu erlangen sowie zur Erstellung von Content, der die Zielgruppe anspricht.
Wettbewerbsbeobachtung
Wer international erfolgreich sein möchte, muss auch das Angebot seiner Konkurrenten in den Zielmärkten kennen und ihnen immer einen Schritt voraus sein. Das bedingt eine permanente Wettbewerbsbeobachtung, die im Online-Handel problemlos über Microtasking beauftragt werden kann. Im Web recherchieren Clickworker bspw. nach Angeboten, Preisen, Konditionen und Sortimenten anderer Online-Händler, die im Zielmarkt tätig sind.
Umfragen
Andere Länder, andere Sitten: Das gilt auch für die Konsumentengewohnheiten in den verschiedenen Zielländern. Um die Zielgruppen besser kennenzulernen und den Shop entsprechend zu optimieren, ist die Microtasking-Methode für Umfragen im Zielland sehr beliebt. Befragt werden hier die Clickworker, die der Zielgruppe bez. Wohnort, Alter und Geschlecht sowie möglichen weiteren Kriterien entsprechen.Gefragt wird hier sowohl nach Konsumverhalten als auch nach Meinungen und Feedback zum Shop.
Texterstellung und Content-Optimierung
Bei Content in Form von Texten wie Produktbeschreibungen, Kategoriebeschreibungen, etc., ist es auch für Online-Händler wichtig, die Sprache der Zielländer korrekt zu benutzen. Einfache Übersetzungen sind da meistens zu starr und reichen nicht aus, um die Tonalität der Zielgruppen zu treffen. Microtasking bietet den Online-Händlern die Möglichkeit, auf die Sprachkenntnisse der Clickworker zuzugreifen. Auch Tausende von neuen Texten in diversen Sprachen können über Microtasking-Anbieter geordert und von Clickworkern der jeweiligen Muttersprache zeitnah erstellt werden.
Weitere Informationen: clickworker
Aufmacherbild / Lizenz: