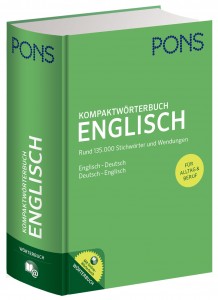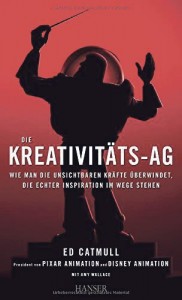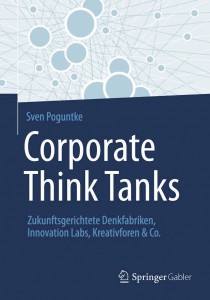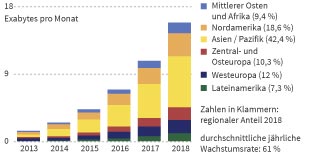Kreativität verändert die Welt. Grundlagen dafür sind Offenheit, Mut und der Wille zum Fortschritt.
Intellekt erklärt die Welt. Kreativität verändert sie. Ein einfacher Satz, den sich manch Chef eingerahmt über seinen Schreibtisch hängen sollte. Kostengünstig produzieren, Prozesse verschlanken, Grundbedürfnisse befriedigen – das gelingt in vielen Teilen der Erde, eben dort, wo die verlängerten Werkbänke der Industrieländer stehen. Doch Global Player mit Marktmacht müssen Trends setzen, innovativ sein, um ihre Position zu halten und auszubauen.
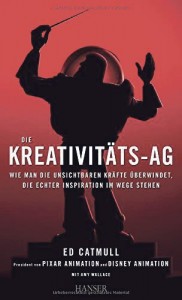
Für jedes Unternehmen stehen Innovation und Kreativität ganz oben auf der Wunschliste. Doch nur wenige schaffen es, immer wieder Neues zu entwickeln. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, ISBN: 978-3446436725; 24,90 Euro
Sie müssen an der Spitze des Fortschritts stehen. Innovation und technologische Transformation im digitalen Zeitalter – die beginnt in den Köpfen kreativer Mitarbeiter. Und die brauchen ein Arbeitsumfeld, in dem ihre Ideen gedeihen: Creative Companies.
Zugegeben, der Begriff ist noch kaum belegt. Er mutet vertraut an, doch er ist kaum mit Inhalten gefüllt. Kreative, die auf eine entsprechende Unternehmenskultur treffen, sind die Mischung, aus der genau das entsteht, was uns morgen umtreiben und die Welt verändern wird. Es ist jene Mischung, von der besonders die Zukunft des Hightech-Standortes Deutschland abhängt. Wem es gelingt, mit frischen Ideen Trends zu setzen, statt sie nur zu kopieren, der wird die Märkte dominieren. Unternehmen wie Apple, IBM, Toyota, Salesforce oder VMware, aber auch Bayer, BMW, Siemens oder SAP machen vor, wie das geht. Ihnen ist klar, dass in einer digitalen Welt Kreativität wichtiger denn je ist. Sie ist der Schlüssel zum Erfolg.
Kreativität, der Schlüssel zum Erfolg
Nur: Wie kann man sie kitzeln? Mit dem Erlernen von sogenannten Kreativtechniken, langem Grübeln und brillanter Logik wird es jedenfalls nicht getan sein. Es ist ein Trugschluss zu meinen, logisches Denken wäre kreatives Denken. Es kommt eher darauf an, Probleme zu erkennen, Neues zu suchen und dabei Wissen aus verschiedenen Welten zusammenzubringen. Trugschluss Nummer 2: Bei einem Brainstorming nach Terminkalender wird das schwerlich gelingen. Creative Companies haben einen anderen Dreh. Und der basiert auf einer besonderen Haltung: „Werde unzufrieden und beginne, es besser zu machen!“ Es ist die Formel für ein kreatives Leben der ehemaligen Google-Entwicklungs- und heutigen Yahoo-Chefin Marissa Mayer.
Auch wenn es banal klingt, müssen Unternehmen zunächst ihren Mitarbeitern die Chance geben, sich mit eigenen Ideen einzubringen. Gerade in hierarchisch strukturierten und ingenieursgetriebenen Betrieben mit hoher Spezialisierung ist das keine Selbstverständlichkeit. Zu oft werden gute Ansätze mit Totschlagsargumenten wie „Das geht nicht!“, „Das gab es noch nie!“, „Das wird zu kostspielig!“, „Das würde ich mir nicht kaufen!“ oder „Das ist reine Spinnerei!“ abgewürgt – und damit die Motivation der Querdenker. Dabei ist „Spinnerei“ schon mal ein guter Ansatz.
Einer, der bei IBM seit Jahren institutionalisiert ist und geradezu Kultcharakter genießt: Für drei Tage treffen sich Jahr für Jahr bis zu 150 000 IBM-Mitarbeiter samt Familien, Kunden, Geschäftspartnern und Wissenschaftlern, um in ihrem virtuellen Netzwerk beim „Innovation Jam“ über neue Ideen zu sinnen. Die Moderatoren des gigantischen weltweiten Kreativ-Spektakels müssen nur die Ideen einsammeln – ein Akt wie eine Apfelernte. Und damit haben sie einiges zu tun: Fast 50 000 Vorschläge kamen schon zusammen – darunter einige neue Geschäftsideen. Über die Top-Ten-Ideen des Happenings stimmt die kreative Gemeinschaft ab. Und alle gehen danach mit dem guten Gefühl auseinander, dass diese Ideen nicht in einer Schublade versacken, sondern IBM Millionen investiert, um herauszufinden, ob die Geistesblitze etwas taugen oder eben nicht.
Damit wird auch über die Innovation-Jam-Tage hinaus ein Klima geschaffen, das zum Um-die-Ecke-Denken und zu ungewöhnlichen Ideen ermutigt, sozusagen eine Ideen-Willkommenskultur. Das ist das, was Kreativforscher und Experten für Arbeitsorganisation fordern: Ein Ideenmanagement, das alle ermutigt, von der Führungsetage bis zum Fließbandarbeiter, Vorschläge zu unterbreiten – auch wenn manche davon zunächst ulkig anmuten mögen. Warum nicht? Jedenfalls muss der Vorstand voll hinter einer solchen Innovationskultur stehen und Mitarbeiter ständig ermutigen, sonst wird dieser Ansatz nicht fruchten.
Kreativität blüht in langfristigen Arbeitsbeziehungen auf

Dr. Jörg Böcking, CTO der Freudenberg-Gruppe, verfolgt das Ziel, dass keine Geistesblitze mehr ungeachtet bleiben.
Der US-Ökonom und Vordenker Richard Florida nennt in seinem Buch „Der Aufstieg der Kreativen Klasse“ drei wesentliche Faktoren dafür, wie sich Kreativität in Unternehmen organisieren lässt: Erstens muss ein Arbeitgeber seinen kreativen Mitarbeitern den Rücken freihalten. Zweitens müssen Manager Kreativität entfachen. Drittens müssen Arbeitgeber kreative Mitarbeiter als eine Investition in die Zukunft begreifen. Das wiederum kann nur gelingen, wenn Unternehmen an einer langfristigen Zusammenarbeit gelegen ist. Denn: „Kreativität blüht in Beziehungen auf, bei Personen, die schon lange zusammen gearbeitet haben.“ Davon ist Florida überzeugt. Was den Einzelnen anbelangt, so benötige er Intelligenz, Neugier, Vorstellungsvermögen, Flexibilität und Mut, um erstaunliche Ideen zu entwickeln. Diese Fähigkeiten zu fördern und ihnen Raum zu bieten ist Sache der Organisation. Wie das geht, zeigt Google. Hier gehören kreative Freiräume zum Alltag aller Mitarbeiter. Jeder hat 20 Prozent seiner Arbeitszeit zur Verfügung, um völlig frei zu forschen. So kommt es, dass an hunderten Projekten gleichzeitig gearbeitet wird – und zwar an Ideen für etliche Branchen und Lebensbereiche. Scherzhaft nennt die Community ihre Arbeitsweise „Spaghetti Approach“. Die Kreativdenker treffen sich, werfen ihre Ideen wie gekochte Nudeln an die Wand und warten ab, was passiert. Die Spaghetti, die herunterfallen, wandern in den Müll. Jene, die kleben bleiben, könnten etwas taugen, das nächste große Ding sein. Hier heißt es: dranbleiben! Mit der „Nudel-Technik“ ist unter anderem der Satellitenbilder-Dienst Google Earth entstanden.
Dieser leichte, unbeschwerte Zugang ohne Denkverbote zeigt auch, dass Kreativität nicht planbar ist – auch wenn manch Trainer und Berater diesen Eindruck vermittelt. Andererseits müssen, sowie neue Ideen in der Welt sind, diese systematisch in neue Produkte und Geschäftsmodelle umgesetzt werden. Doch daran hapert es. Gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen findet sich häufig kein professionelles Innovationsmanagement, hat die Unternehmensberatung A.T. Kearney herausgefunden. Eine Innovationstrategie, -kultur und -organisation zu schaffen sowie ein rigides Lebenszyklusmanagement anzuwenden seien Werkzeuge, die vielen meist nur oberflächlich bekannt sind. Wo es an derartigen Strukturen und Fähigkeiten mangele, falle es schwer, kontinuierlich brauchbare Innovationen zu finden.
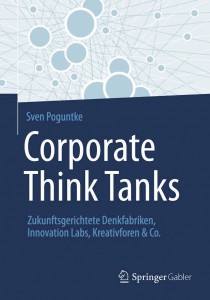
Um neue Konzepte, Strategien und Innovationen zu entwickeln, kommen in Unternehmen immer häufiger sogenannte Think Tanks zum Einsatz. Springer Gabler, ISBN: 978-3658043179; 39,99 Euro
Besonders schwer fällt das deutschen Traditionsunternehmen, die mit einem „Das haben wir immer schon so gemacht!“ glauben, gut zu fahren. Sie irren. Wie es anders geht und wie sich gezielt die neuen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters nutzen lassen, demonstriert Villeroy & Boch. Die jahrhundertelange Unternehmensgeschichte hat die Firma nicht davon abgehalten, einen neuen Weg zu beschreiten, um neue junge Zielgruppen mit Geschenkartikeln aus Keramik zu erreichen. Florian Bausch, Leiter Produktmanagement und -entwicklung im Unternehmensbereich Tischkultur, beauftragte die virtuelle Designcommunity der Berliner Crowdsourcing-Plattform jovoto, neue Dekore für die Keramik zu entwerfen. „Dass wir speziell beim Design, unserer seit über 265 Jahren gefestigten Kernkompetenz, auf eine anonyme Online-Kreativcommunity zurückgegriffen haben, war absolutes Neuland für uns“, räumt Bausch ein. Eine Öffnung, die sich ausgezahlt hat: „Es hat sich gezeigt, dass diese externe Perspektive für neue Impulse in der Produktentwicklung sorgt. Wir sind mit den Designs sehr zufrieden und davon überzeugt, dass es unsere Kunden auch sein werden“, betont Bausch. Villeroy & Boch wird weiterhin auf dieses Instrument setzen, um frische Ideen zu finden und sich eine globalere Sicht anzueignen. Bausch: „Nebenbei haben wir noch erfahren, wie unsere Marke weltweit wahrgenommen wird.“
Mit dem Netzwerk des 2007 an der Hochschule für Künste in Berlin gegründeten Online-Unternehmens jovoto gelingt das reibungslos: Derzeit sind über die Plattform 60 000 Designer, Architekten und andere Kreative aus 150 Ländern vernetzt, die auch über Aufträgen für Produktdesigns und Innovationen von Konzernen wie Audi, Coca Cola, Deutsche Bahn oder Continental brüten. Bei jovoto ist auch nicht mehr von „Brainstorm“, sondern von „Crowdstorm“ die Rede.
Uni-Start-Ups
Die wichtigsten Start-up-Universitäten anhand des „Gründerszene Hochschul-Rankings“ (Anzahl der Köpfe in der „Gründerszene-Datenbank“):
| WHU – Otto Beisheim School of Management: |
107 |
| Ludwig-Maximilians-Universität in München: |
81 |
| Freie Universität Berlin: |
64 |
| Technische Universität Berlin: |
53 |
| European Business School, International University Oestrich-Winkel: |
52 |
| Universität Hamburg: |
48 |
| Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie (KIT): |
43 |
| Technische Universität München: |
40 |
Quelle: www.gruenderszene.de
Die Kreativität der Vielen macht sich auch das Software-Haus Haufe-umantis zunutze. Feste Abteilungen wurden in der Firma, die radikal mit alten Strukturen und vermeintlichen Gewissheiten bricht, weitgehend abgeschafft. Klassische Manager dito. Jeder Mitarbeiter entscheidet nun selbst, welches Projekt seine Energie am nötigsten braucht – so organisieren sich automatisch Schwärme, die eine Aufgabe vorantreiben. Es zeigt sich, dass die Mitarbeiter selbst am besten wissen, wo es brennt und was zu tun ist. So viel Freiraum und Eigenverantwortung treibt zu neuen Ideen an. „Swarming“ nennt sich das Organisationsmodell neudeutsch. „Ein Schwarm arbeitet in der Regel projektbezogen“, erklärt Geschäftsführer Marc Stoffel. Die rund 30 Mitarbeiter, die im Bereich Programmieren und Testen arbeiten, haben sich in vier bis fünf Schwärme eingeteilt. Die Verantwortung ist dabei auf mehrere Schultern verteilt: „Der Product-Owner übernimmt die Priorisierung von Anfragen, der Scrum-Master sorgt dafür, dass die Aufgaben reibungslos durchgeführt werden können“, berichtet Stoffel. Die Teams stimmen gemeinsam darüber ab, welches Feature oder welche Produkterweiterung als nächstes realisiert werden sollte. „Das geschieht immer aus der Perspektive heraus: Was hilft unseren Kunden dabei, erfolgreicher arbeiten zu können?“, sagt Stoffel. In „Daily Scrums“, kurzen Besprechungen, kommen alle Schwarmteilnehmer morgens für etwa eine halbe Stunde zusammen und berichten über Fortschritte, Probleme und Erkenntnisse vom Vortag. Gemeinsam wird auch besprochen und entschieden, wie weitergemacht wird und wieviel Zeit für die nächsten Schritte zu veranschlagen ist. „So lässt sich realistischer und zuverlässiger planen, als wenn Timelines starr vorgegeben werden. Zudem steigt die Motivation und Zufriedenheit der Teammitglieder, da das Gefühl von Überforderung nicht so schnell eintritt, wie bei Top-down-Vorgaben“, sagt Stoffel.
Das Wissen der Vielen nutzen
Er hat ohnehin schwere Zweifel daran, ob klassische Top-down-Strukturen überhaupt noch angebracht sind. Vor allem in kreativen Bereichen, wie der Forschung & Entwicklung, hält er davon nichts: „Rein hierarchisch geführte Unternehmen können nicht mehr mit den aktuellen Marktentwicklungen mithalten – Innovationskraft geht verloren.“ Konsequenterweise werden bei Haufe-umantis die Chefs von ihren Mitarbeitern gewählt. Leitungspositionen werden jedes Jahr neu im Rahmen einer Wahl der rund 150 Mitarbeiter vergeben, wobei sich jeder für eine Führungsposition ins Spiel bringen kann. Effekt: Nicht etwa Konkurrenzgehabe samt quälenden Wahlkämpfen wurde geweckt, sondern die Solidarität und die Verantwortung jedes Einzelnen für den Unternehmenserfolg gesteigert. Außerdem werden alle Mitarbeiter in die Festlegung der Strategie und des Geschäftsplans samt Finanz- und Personalplanung miteinbezogen.
Neue Werte für kreative Unternehmen
Dieses Beispiel zeigt, was in Creative Companies zählt: partnerschaftliche Zusammenarbeit, die idealerweise das Wissen der Vielen nutzt. Kreative Unternehmen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie die Kooperation mit Forschungsinstituten und Universitäten suchen. Der international tätige Automobilzulieferer Brose sucht diese Nähe und investiert zudem etwa acht Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Dabei entstehen dann Lösungen wie der „Handsfree Access“, mit dem sich per Fußbewegung unter dem Stoßfänger eines Autos die Heckklappe öffnen lässt, was jeder zu schätzen weiß, der schwer bepackt vom Einkaufen kommt. Immer wieder wird das Familienunternehmen für seine Innovationsfähigkeit ausgezeichnet. So zuletzt im Rahmen eines branchenübergreifenden Benchmarkings von einem Industriekonsortium führender Unternehmen für sein intelligentes Baukastenmanagement bei der Produktion von Sitzen. Der Clou hierbei ist eine modulare Konstruktion, durch die standardisierte Komponenten, die kundenübergreifend eingesetzt werden, unkompliziert mit individualisierbaren Bauteilen verbunden werden können. Durch die Modularisierung reduziert der Automobilzulieferer seine Entwicklungszeiten um bis zu 25 Prozent und kann dem Kunden gleichzeitig ein auf seine Anforderungen angepasstes Produkt anbieten. Das ermöglicht Autoherstellern beispielsweise, sichtbare Verstellelemente nach eigenen Wünschen zu designen und trotzdem auf Standardelemente in der Sitzstruktur zurückzugreifen. Dieses Baukasten- und Variantenmanagement gilt in der Branche als Trendsetter.

Cradle-to-Cradle verändert laut Ludwig Cammaert, Director Design & Technical Development bei Desso die komplette Herstellungsweise.
Hohe F & E-Aufwendungen, vielfältige Forschungskooperationen und ein gezieltes Ideenmanagement lassen auch Firmen wie Fischer, Festo oder Trumpf zu Innovationsführern werden. Trumpf gilt als Technologieführer in der industriellen Materialbearbeitung. Auch, weil die Geschäftsführung das Ideenmanagement zur Chefsache macht und steuernd darauf hinwirkt, dass strategische Ziele des Unternehmens durch ständige Innovationen erreicht werden. Trumpf leistet sich sogar hauptberufliche Ideenmanager, die Geistesblitze der Mitarbeiter sammeln, bewerten und in Konzepte überführen. Sie entscheiden in erster Instanz über den Innovationsgrad einer Idee, vermitteln Ansprechpartner und leiten alles Weitere in die Wege. Die Ideenmanager sind die Basis in einem ausgeklügelten Innovationsmanagementprozess, an dem sich möglichst viele beteiligen sollen. Wichtig dabei ist, dass der gesamte Prozess straff organisiert ist, weil sonst Ideen zu versacken drohen und Mitarbeiter demotiviert werden. Daher gibt es bei Trumpf eine eiserne Regel: Es dürfen nicht mehr als fünf Tage vergehen, bis ein Mitarbeiter des Maschinenbauers seine Idee mit einem Ideenmanager bespricht und beide mal abklopfen, ob sie weiter verfolgt werden soll. Wenn ja, schließt sich ein definierter Prozess an, bei dem geprüft wird, ob es Sinn macht, den Gedanken weiterzuverfolgen, etwa hin zu einem Entwicklungsprojekt. Es gibt klare Kriterien, die abgearbeitet werden, etwa ob die Innovation zur Geschäftsstrategie passt, was der Wettbewerber zu bieten hat, ob nur ein Nischenmarkt erschlossen werden kann und natürlich ob die Sache technisch zu vertretbaren Kosten machbar ist. Anhand von Meilensteinen entscheiden interdisziplinäre Teams aus Experten und Führungskräften über Fortsetzung oder Abbruch des Innovationsprozesses sowie die konkreten nächsten Schritte. Auf was es Trumpf dabei ankommt ist, ein Maximum an Ideen aus den Mitarbeitern herauszukitzeln, die besten davon aber mit möglichst minimalem Aufwand herauszufiltern.
Spielerisch Ideen finden
Beim Ideenfindungsprozess kann auch ein spielerischer Ansatz hilfreich sein. Die IMC AG aus Saarbrücken, ein führender E-Learning Anbieter, entwickelt so genannte „Serious Games“, um Lern- und Kreativitätsprozesse anzuschieben. Die Firma ist dabei trendbildend für den Markt digitalen Lernens, der vermehrt auf „Game Based Learning“ und „Gamification“ setzt. Bei Letzterem werden die Techniken des Game-Designs in einem nichtspielerischen Kontext genutzt. Damit wird direkt an die Erlebniswelten und Bedürfnisse der Digital Natives angeknüpft, wozu auch gehört, dass nun nicht mehr nur am Arbeitsplatz gelernt wird, sondern dank Smartphones und Tablets dann, wenn es den Anwendern passt und sie darauf Lust haben. So ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das Spiel, bei dem etwa ein Zukunftsszenario entworfen werden soll, Gedanken und Ideen zum Fließen bringt. Gerade bei Themen, die uns umtreiben, wie die Einteilung von Ressourcen und die Verschmutzung der Umwelt und wie darauf mit smarten nachhaltigen Ideen reagiert werden kann, eignet sich das Serious Game.
Ideenmanagement muss zur Chefsache werden
Eine interessante und überraschende Antwort darauf gibt die Firma Desso, ein führender europäischer Hersteller von Teppichböden. Das Unternehmen setzt beharrlich seit Jahren auf das Cradle-to-Cradle-Konzept und ist damit zum Trendsetter in Sachen Kreislaufwirtschaft geworden. Die Produktionsweise „Von der Wiege zur Wiege“ (Cradle-to-Cradle) kennt, wie die Natur, keinen Abfall, ohne jedoch technologisch oder qualitativ Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Im Gegenteil. Über biologische und technische Stoffkreisläufe werden Materialien zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort eingesetzt, so dass es zu keinen Überschüssen kommt. Damit steht dieses Prinzip im Gegensatz zu noch häufig vorherrschenden Produktionen, bei denen Materialströme ohne Rücksicht auf Ressourcenerhaltung fließen. Vielmehr setzt Desso auf zyklische Nährstoffkreisläufe, so dass einmal geschöpfte Werte für Mensch und Umwelt erhalten bleiben.

Vom Internet-Nerd zum Twitter-Gründer. Ariston Verlag, ISBN: 978-3424201147; 19,99 Euro
Dabei werden Innovationen entwickelt, die direkt Mensch und Umwelt zugutekommen. Wie Teppich-Produkte, die Feinstaub aus der Raumluft binden oder Schall dämmen und absorbieren. „Cradle-to-Cradle umfasst die Umgestaltung unserer Herstellungsweise, sodass unsere Teppiche von Anfang an positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit haben, was bereits bei der Verwendung von unschädlichen Materialien beginnt“, so Ludwig Cammaert, Director Design & Technical Development. Jeder chemische Inhaltsstoff, der verwendet werden soll, wird zunächst daraufhin eingehend überprüft, ob er gesundheitlich und ökologisch unbedenklich ist. Für den innovativen Teppich namens AirMaster wurde eine besondere Mischung aus feinen und groben Fasern entwickelt, die es ermöglicht auch kleinste Staubpartikel zu binden. Solche Entwicklungen werden durch ein Innovationsprogramm angetrieben, das auf drei Grundsätzen fußt: Kreativität, Funktionalität und eben Cradle-to-Cradle.
Gerade kleine und mittlere Unternehmen, die schon lange am Markt mit ihrer Produktpalette bestehen, müssen solche Prozesse dringender denn je vorantreiben, sich in Richtung Creative Company wandeln, um gegen die Konkurrenz bestehen zu können und sich als Trendsetter immer wieder neu zu erfinden. Wobei für alle Marktteilnehmer – gleich welcher Branche – die Regel gilt: Die Innovationszyklen werden tatsächlich immer kürzer.
Das hat die Freudenberg-Gruppe beizeiten begriffen und im Jahr 2007 nicht nur einen konzernweiten Ideenpool ins Leben gerufen, sondern den Innovationsprozess straff durchorganisiert, denn aus dem mittelständischen Familienunternehmen ist im Laufe der Jahre ein Konzern mit mehr als 400 Gesellschaften in 60 Ländern geworden. „Somit arbeiten viele potenzielle Ideengeber bei Freudenberg. Ein Potenzial, das nicht leicht zu erschließen ist“, weiß Dr. Jörg Böcking, Chief Technology Officer der Freudenberg- Gruppe. Doch mit dem Ideenpool, einer Plattform im Intranet und Ansprechpartnern in den Geschäftsgruppen, den sogenannten „Business Unit Scouts“, sollen keine Geistesblitze mehr unbeachtet bleiben, auch wenn sie nicht ins direkte Arbeitsumfeld des Mitarbeiters passen oder auf Bedenken des direkten Vorgesetzten stoßen.
Expertenpanel
Wir haben auf unserer Webseite für Sie weitere spannende Interviews zum Thema „Creative Companies“ zusammengestellt. Lesen Sie außerdem alle Interviews und Fallbeispiele der Print-Ausgabe in voller Länge.
trendreport.de/expertenpanel
Ideenkoordinatoren und Business Unit Scouts unterstützen Mitarbeiter bei der Ausformulierung ihrer Vorschläge und in Detailfragen. Wie die Idee eingereicht wird, ist erst mal egal: „Ein einzelner Satz ist dem Ideenkoordinator ebenso willkommen wie eine mehrseitige Ausarbeitung“, sagt Böcking. Der Ideenkoordinator stellt sicher, dass keine Idee verloren geht und diese den gesamten Bewertungsprozess durchläuft sowie in einer Datenbank dokumentiert und aufbewahrt wird – über alle Schritte wird der Urheber informiert. Wird ein weiterführendes Projekt daraus, lockt stufenweise eine Prämie von bis zu 30 000 Euro. Manchmal kann der Ideengeber sogar zum Projektleiter seines eigenen Vorschlags werden.
„Es gibt keine logische Methode für das Entstehen neuer Ideen oder eine logische Rekonstruktion dieses Prozesses. Alle großen Entdeckungen beinhalten ein irrationales Element kreativer, intuitiver Eingebung“, schrieb einst der Philosoph Karl Popper. Wie wahr. Wahr ist aber auch, dass Creative Companies diesen Prozess aktiv anstoßen und befördern müssen. Denn das kreative Umfeld, der Nährboden, der für disruptive Ideen bereitet wird, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg.
Open Access

Open Access
Als Open Access (englisch für offener Zugang) wird der freie Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und anderen Materialien im Internet bezeichnet. Ein wissenschaftliches Dokument unter Open-Access-Bedingungen zu publizieren, gibt jedermann die Erlaubnis, dieses Dokument zu lesen, herunterzuladen, zu speichern, es zu verlinken, zu drucken und damit entgeltfrei zu nutzen. Darüber hinaus können über Freie Lizenzen den Nutzern weitere Nutzungsrechte eingeräumt werden, welche die freie Nach- und Weiternutzung, Vervielfältigung, Verbreitung oder auch Veränderung der Dokumente ermöglichen können. Quelle: Wikipedia
http://open-access.net