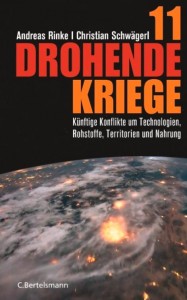Beteiligungen: 115 Millionen US-Dollar für die Subscription Economy
Unternehmen aller Branchen setzen zunehmend auf Geschäftsmodelle mit Subscription – die Investitionssumme von 115 Millionen US-Dollar für Zuora unterstreicht die Bedeutung dieses Trends. Die jüngste Finanzierungsrunde erhöht das Gesamtkapital für Zuora auf 250 Millionen US-Dollar. Zu den neuen Investoren zählen Wellington Management Company LLP, Blackrock Inc., PremjiInvest sowie Passport Capital. Sie ergänzen die bestehenden Investoren Benchmark Capital, Greylock Partners, Redpoint Ventures, Index Ventures, Shasta Ventures, Vulcan Capital, Next World Capital, Dave Duffield (Mitgründer und Chairman of the Board von Workday) sowie Marc Benioff (Chairman und CEO von Salesforce.com), die sich ebenso wieder beteiligt haben.
Ausgestattet mit entsprechender Liquidität hat das Unternehmen nun auch den deutschsprachigen Markt im Visier: In München wurde ein erstes Büro eröffnet, Kunden wie Unify und Matrix42 sind bereits an Bord und das Team, zuständig für die DACH-Region und Osteuropa, wächst kontinuierlich.
Zwischen CRM und ERP: Zuora steht für eine neue Softwarekategorie
Zuora ist eines der am schnellsten wachsenden Software-as-a-Service- (SaaS-) Unternehmen der Welt. Mit dessen Plattform für Relationship Business Management (RBM) können Unternehmen den gesamten Subscriber-Lebenszyklus verwalten – von der Kundenregistrierung über wiederkehrende Zahlungen und Umsatzrealisierung bis hin zur Analyse von Subscription-Kennzahlen. Mit dem zusätzlichen Investitionskapital wird Zuora die globale Expansion in neue Regionen und Märkte fortsetzen, weitere erstklassige Mitarbeiter in Vertrieb, Entwicklung und Marketing anwerben sowie Forschung und Entwicklung vorantreiben.
„Die Subscription Economy durchdringt jede Branche: Entertainment, Technologie, das Gesundheitswesen, die Industrie einschließlich dem Internet der Dinge, Verbraucherprodukte, einfach alles. Kunden sind heute Subscriber und durch eine neue Form der Zielgruppenansprache, der Abrechnung und der Kundenbindung lassen sich diese Beziehungen monetarisieren“, sagt Tien Tzuo, Mitgründer und CEO von Zuora. „Unsere Finanzierungspartner verstehen, dass dieser Wandel eine milliardenschwere Chance für eine neue Softwarekategorie zwischen bestehenden CRM- und ERP-Systemen darstellt. Die Investoren, insbesondere Blackrock und Passport Capital, bringen die strategische Erfahrung mit, mit der Zuora diese gewaltige Möglichkeit am Schopfe packen kann.“
Exzellente Marktaussichten
Seit der Gründung im Jahr 2007 setzt Zuora auf den Trend hin zu Geschäftsmodellen auf Subscription-Basis. Geschäftliche Transaktionen verändern sich – von dem Kauf von Produkten hin zum Service-Abonnement. Unternehmen wie Salesforce.com, Amazon, Netflix und Box waren die Vorreiter der Subscription Economy. Nun ergeben sich neue Möglichkeiten, da andere Unternehmen diesem Beispiel folgen.
Unternehmen aller Branchen – von Energie, Handel, über Gesundheits- und Bildungswesen, Verbraucherprodukte, Finanzdienstleistungen bis hin zur Telekommunikation – suchen neue Wege für Preisgestaltung (Pricing), Rechnungsstellung (Billing) und Aufbereitung der finanzrelevanten Daten (Finance), mit denen sich die innovativen und disruptiven Geschäftsmodelle sowie die nötigen Prozessveränderungen für die neue Ära der Kundenfokussierung umsetzen lassen. Die Verantwortlichen für Vertrieb, Marketing und Finance nutzen Zuora, um die Art und Weise der Kundenbeziehung, -akquise und -weiterentwicklung überall auf der Welt neu zu definieren.
Rasantes Wachstum im Jahr 2014
Zuora ist im Jahr 2014 äußerst stark gewachsen und expandiert. Die Anzahl der Rechnungen, die von Zuora-Systemen verwaltet werden, konnte um 109 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Insgesamt repräsentieren diese einen Rechnungswert von ungefähr 42 Milliarden US-Dollar. Das globale Wachstum des Unternehmens erreichte 106 Prozent gegenüber dem Vorjahr, acht neue Niederlassungen wurden eröffnet und die weltweite Mitarbeiteranzahl stieg auf 500.
„Unternehmen setzen verstärkt auf Subscription-Modelle, da sie den Innovationsdruck als erfolgsentscheidend erkennen“, sagt R. „Ray“ Wang, Principal Analyst und CEO bei Constellation Research. „Die SaaS-Angebote waren nur der Anfang – mittlerweile spürt jedes Unternehmen Erschütterungen des herkömmlichen Geschäftsmodells. In einer Post-Sales-Wirtschaft liegt der Fokus nicht mehr auf dem Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen sondern auf dem Beziehungsmanagement und der Erfüllung des Markenversprechens.“
„In vielen Branchen werden Erfahrungen und Beziehungspflege immer wichtiger bis hin zum Ersatz von Produktkatalogen, Warenkörben und Besitz“, sagt Amy Konary, Research Vice President bei IDC. „In dieser neuen Ära beruht Erfolg auf der Monetarisierung von Beziehungen und nicht mehr auf dem bloßen Verkauf von Produkten. Zuora hat eine Schlüsselrolle inne bei der Einführung dieser Geschäftsmodelle.“
Hinweis: Dies ist eine Pressemitteilung. Bitte gesonderte Rechte beachten.