Geschäftsrisiken sind ein wichtiges Thema für Betriebsleiter:innen – vor allem, weil es sich um Fehler handelt, die sie Zeit und Geld kosten
Betriebsleiter:innen jonglieren täglich mit unterschiedlichen Risiken. Es ist ihre Aufgabe, bestehende Risiken zu bewerten und abzuschwächen sowie Strategien zur Vermeidung künftiger Risiken zu entwickeln. Dabei steht viel auf dem Spiel: Risikofolgen reichen von Produktivitätsverlusten – während die Mitarbeiter:innen mit der Behebung von Fehlern beschäftigt sind – bis hin zu Geldverschwendung, wenn Fristen und Fortschritte nicht eingehalten werden.

Cosima von Kries, Nintex Director, Solution Engineering EMEA.
„Ein Risikomanagementplan hilft Führungskräften dabei, Risiken bestmöglich zu steuern. Er erfordert eine sorgfältige Analyse, um Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung im Interesse der Effizienz zu treffen. Letztendlich ist es das Ziel einer Führungskraft, unvermeidbare Risiken in Chancen für einen erfolgreichen Betrieb umzuwandeln – und das ist keine leichte Aufgabe,“ weiß Cosima von Kries, Nintex Director, Solution Engineering EMEA.
Compliance, Regulierung und betriebliche Risiken
Betriebsleiter:innen sind ständig auf der Suche nach Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sowie nach betrieblichen Risiken, die sich negativ auf den Betriebsablauf auswirken könnten.
Sich ändernde Gesetze und Vorschriften stellen ein Risiko für Unternehmen dar, die die notwendigen Änderungen nicht schnell genug umsetzen können, um die Vorschriften einzuhalten. Die Bewältigung dieser Risiken kann Zeit und Ressourcen vom normalen Geschäftsbetrieb abziehen.
Zu den operativen Risiken gehören Fehler oder Versäumnisse, die während des Tagesgeschäfts auftreten und schnell behoben werden müssen, um größere Unterbrechungen zu vermeiden. Alle diese Arten von Risiken stellen eine zusätzliche Belastung für Betriebsleiter:innen dar, da sie sich mit allen Abteilungen abstimmen müssen, um potenzielle Probleme zu entschärfen. Dies nimmt wieder Zeit und Ressourcen in Anspruch, welche ohnehin knapp verfügbar sind.
„Für Betriebsleiter:innen können die Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften, gesetzlichen Bestimmungen und betrieblichen Abläufen schnell überwältigend werden, wenn sie diese nicht richtig handhaben. Ein Beispiel für ein solches Risiko sind zu komplexe, manuelle Prozesse, die zu Ineffizienzen führen. Ganz gleich, ob es sich um Kundendienstvereinbarungen oder die Implementierung neuer Systeme handelt, jede Art von Risiko kann zu unerwarteten Ineffizienzen und Fehlern führen, die das Unternehmen letztendlich übermäßig viel Geld kosten und die Produktivität beeinträchtigen,“ erklärt Cosima von Kries genauer.
„Ein gutes Prozessmanagement stellt sicher, dass die Prozesse regelmäßig aktualisiert und automatisiert werden, um alle Änderungen zu berücksichtigen.“
Risikomanagementplan mit Geschäftsprozessmanagement und Automatisierung
Um potenzielle Risiken im Griff zu behalten, benötigen Führungskräfte proaktive Prozesse, die Risiken antizipieren, identifizieren und verwalten, bevor sie zu einer echten Bedrohung für das Unternehmen werden. Wenn die richtigen Prozesse implementiert und automatisiert werden, können Betriebsleiter:innen in jeder Situation mit Zuversicht präzise Strategien anwenden und die Chancen auf störende Auswirkungen mindern.
Cosima von Kries weist darauf hin, dass Prozessmanagement und -automatisierung Führungskräften mehr denn je die Möglichkeit geben, Risiken zu minimieren; dies sollten alle Führungskräfte als Teil ihrer Managementstrategie in Betracht ziehen.
Die Prozessautomatisierung verringert das Risiko weiter, indem sie fehleranfällige, sich wiederholende und manuelle Prozesse automatisiert und so die Datengenauigkeit und Prozesseffizienz verbessert. Diese proaktive Strategie hilft operativen Teams, potenzielle Fehler zu erkennen und zu beseitigen, bevor sie auftreten, und spart so Zeit und Geld. Außerdem können die Verantwortlichen den Fortschritt in Echtzeit überwachen und sicherstellen, dass unvorhergesehene Risiken schnell erkannt und behoben werden.
Beispiele hierfür sind digitale Formulare, automatisierte Dokumentenzusammenarbeit, Workflows, robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA), Geschäftsregelmanagement, analytisches Dashboarding, Datenintegrationslösungen und kollaborative Entscheidungsfindung.
Kontinuierliche Prozesspflege und -steuerung
Prozesse sind nur dann sinnvoll, wenn sie regelmäßig verwaltet und aktualisiert werden, damit sie die aktuellen Geschäftsabläufe einer Organisation widerspiegeln. Wenn Prozesse nicht die aktuellen Geschäftspraktiken widerspiegeln, kann dies zu fehlerhaften Prozessen führen, die nicht mit der Arbeitsweise eines Unternehmens vereinbar sind.
„Viele Unternehmensabteilungen entscheiden sich dafür, Prozessprobleme zu umgehen, was die Produktivität langsam untergräbt und das Risiko für das Unternehmen erhöht. Der Auslöser für eine Änderung kann ein verlorener Kunde, ein Verstoß gegen Vorschriften oder Bestimmungen, ein fehlgeschlagenes Audit oder sogar eine Rufschädigung sein, so Cosima von Kries.
Ein gutes Prozessmanagement stellt sicher, dass die Prozesse regelmäßig aktualisiert und automatisiert werden, um alle Änderungen zu berücksichtigen. Dies hat das Potenzial, die Effizienz des Betriebsteams durch Rationalisierung der Abläufe und Identifizierung potenzieller Risiken deutlich zu verbessern.
Kaputte Prozesse = unkontrolliertes Risiko
Als Nintex 2023 eine Untersuchung durchführte, um die weltweit am häufigsten unterbrochenen Prozesse besser zu verstehen, befragten es über 1.400 Großunternehmen in 12 Ländern. Laut den Befragten weisen die Betriebsabteilungen mehr fehlerhafte Systeme und Prozesse auf als jede andere Abteilung. 77 % der Befragten gaben an, dass die Betriebsabteilungen auch ein Hindernis für die Automatisierung ihrer eigenen Prozesse darstellen können.
Die wichtigsten Informationen zum Aufbau eines Risikomanagementplans finden Interessierte in einem separaten eBook.
Es behandelt die folgenden Themen:
– Die wichtigsten Geschäftsrisiken, die Betriebsleiter kennen sollten
– Tipps für einen ganzheitlichen Ansatz zum Risikomanagement
– Wie Unternehmen Prozessmanagement und Automatisierung für das Risikomanagement nutzen
Das eBook in englischer Sprache kann hier kostenfrei herunterladen werden: https://resources.nintex.com/managing-risk/risk-is-a-problem
Aufmacherbild / Quelle / Lizenz
Image by Gerd Altmann from Pixabay
![]() Das numerische Modell ICON ermöglicht effiziente Wettervorhersagen und Klimaprojektionen. Mit ICON-ART hat das KIT das System um eine Komponente erweitert, um zu untersuchen, wie sich etwa Treibhausgasemissionen und Staubwolken von Saharastürmen ausbreiten oder wie sich Asche und andere Aerosole aus Vulkanausbrüchen auf Wetter und Klima auswirken. Das Modell steht nun unter einer Open-Source-Lizenz der Öffentlichkeit zur Verfügung und soll zu mehr Transparenz in der Wissenschaft beitragen.
Das numerische Modell ICON ermöglicht effiziente Wettervorhersagen und Klimaprojektionen. Mit ICON-ART hat das KIT das System um eine Komponente erweitert, um zu untersuchen, wie sich etwa Treibhausgasemissionen und Staubwolken von Saharastürmen ausbreiten oder wie sich Asche und andere Aerosole aus Vulkanausbrüchen auf Wetter und Klima auswirken. Das Modell steht nun unter einer Open-Source-Lizenz der Öffentlichkeit zur Verfügung und soll zu mehr Transparenz in der Wissenschaft beitragen.


 Prof. Dr. Nils Urbach ist Inhaber der Professur für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Digital Business & Mobilität, und Direktor des Research Lab for Digital Innovation & Transformation (ditlab) an der Frankfurt University of Applied Sciences. Zudem ist er Direktor am FIM Forschungsinstitut für Informationsmanagement und am Institutsteil Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik FIT sowie Mitgründer und -leiter des Fraunhofer Blockchain-Labors. Seine Schwerpunkte in Lehre und Forschung umfassen Digitale Innovation und Transformation, Blockchain & Distributed Ledger Technologies, Management von Künstlicher Intelligenz und Strategisches IT-Management. Näheres zum ditlab unter:
Prof. Dr. Nils Urbach ist Inhaber der Professur für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Digital Business & Mobilität, und Direktor des Research Lab for Digital Innovation & Transformation (ditlab) an der Frankfurt University of Applied Sciences. Zudem ist er Direktor am FIM Forschungsinstitut für Informationsmanagement und am Institutsteil Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik FIT sowie Mitgründer und -leiter des Fraunhofer Blockchain-Labors. Seine Schwerpunkte in Lehre und Forschung umfassen Digitale Innovation und Transformation, Blockchain & Distributed Ledger Technologies, Management von Künstlicher Intelligenz und Strategisches IT-Management. Näheres zum ditlab unter: 



 Hans Elstner ist Gründer und CEO der 2016 gegründeten rooom AG. Das Thüringer Unternehmen bietet Unternehmen weltweit eine Web-basierte Plattform, um digitale Welten, Showrooms, Events und mehr selbst zu gestalten und ist Landessprecher Thüringen des Startup-Verbandes Deutschlands
Hans Elstner ist Gründer und CEO der 2016 gegründeten rooom AG. Das Thüringer Unternehmen bietet Unternehmen weltweit eine Web-basierte Plattform, um digitale Welten, Showrooms, Events und mehr selbst zu gestalten und ist Landessprecher Thüringen des Startup-Verbandes Deutschlands


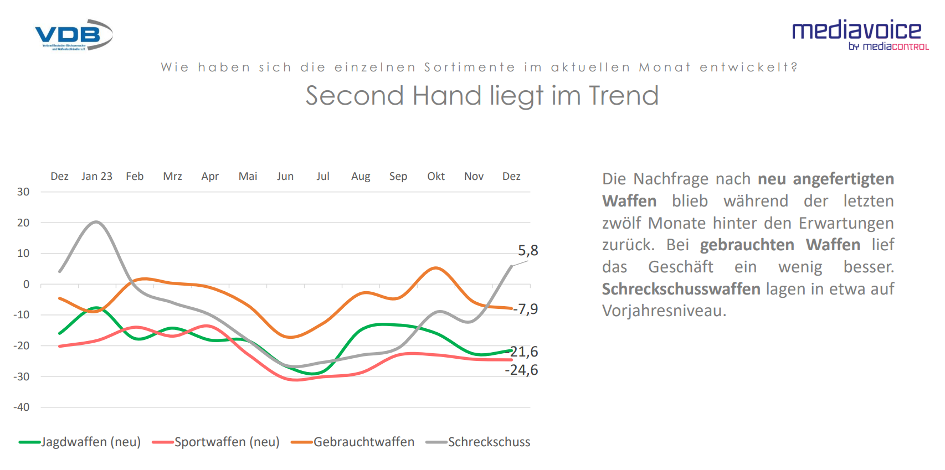
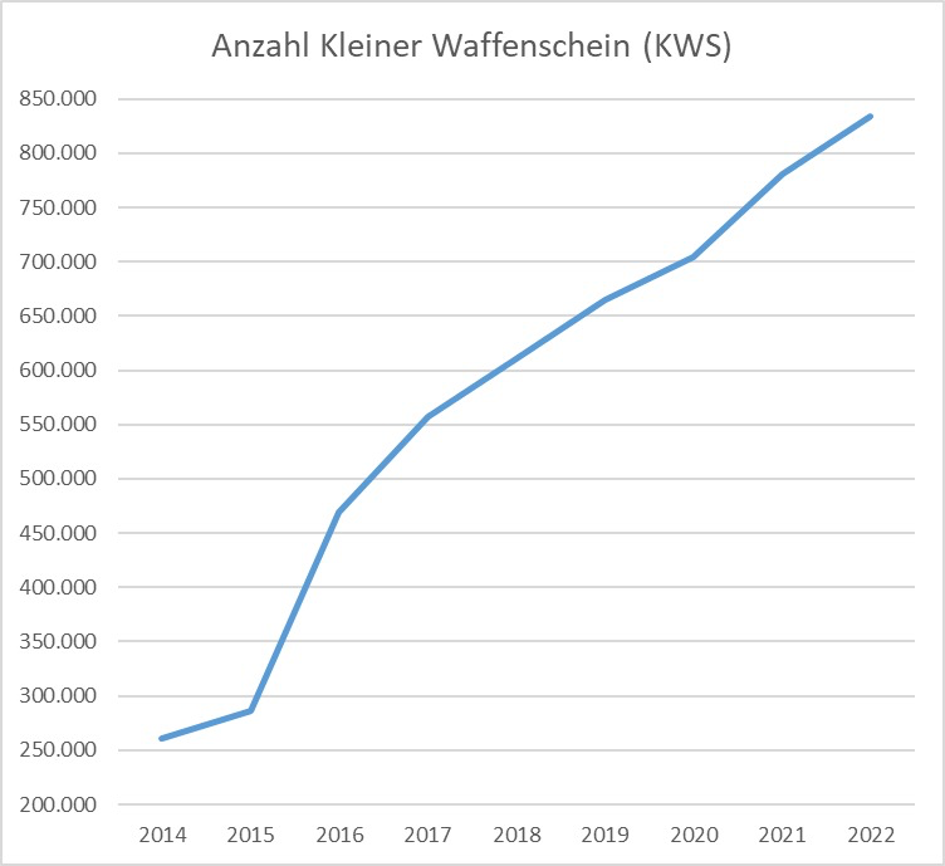

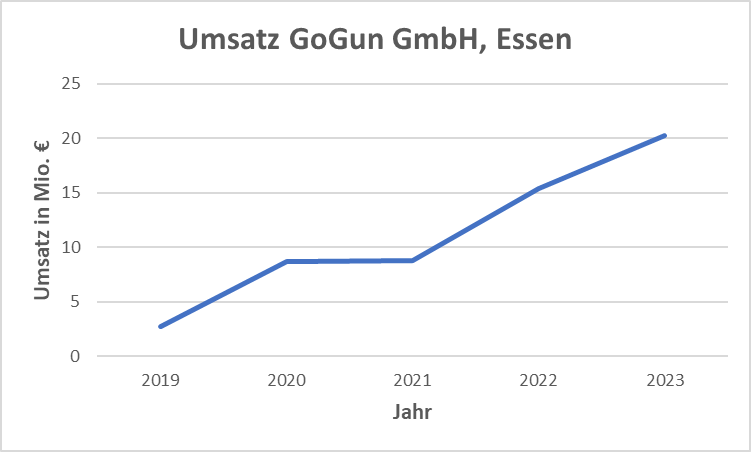

 Dr. Frauke Goll, Managing Director des appliedAI Institute for Europe, kommentiert die Ergebnisse der Studie: „Generative KI-Startups sind an der Spitze neuer technologischer Entwicklungen und treiben Europas Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft voran.
Dr. Frauke Goll, Managing Director des appliedAI Institute for Europe, kommentiert die Ergebnisse der Studie: „Generative KI-Startups sind an der Spitze neuer technologischer Entwicklungen und treiben Europas Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft voran.