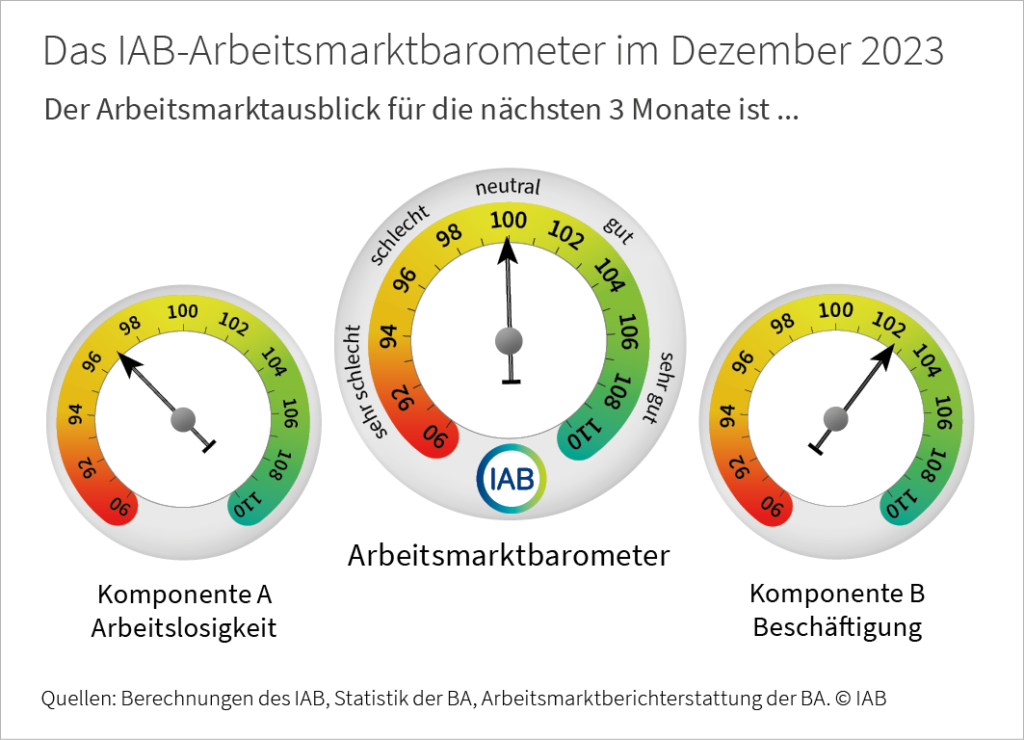Diese fünf Trends werden Retail Media 2024 revolutionieren
Immer mehr Retailer und Markenhersteller entdecken das riesige Potenzial von Retail Media für sich – egal ob On-Site, Off-Site oder ganz analog über physische Werbeflächen. CitrusAd wirft einen Blick voraus auf die Themen und Trends, die den Bereich Retail Media 2024 bestimmen werden.
Ob die gezieltere Ansprache der wirklich relevanten Zielgruppen, eine starke Kundenbindung oder maßgeschneiderte Angebote dank fortschrittlicher Personalisierung: die Vorteile von Retail-Media-Maßnahmen überzeugen auch in Europa und Deutschland immer mehr Markenhersteller und Retailer.
Gestützt wird die starke Nachfrage von technologischen Innovationen, die aus klassischen Kampagnen ganzheitliche Omnichannel-Marketingstrategie
- Die Zahl der Kooperationen steigt. Einzelhändler haben das volle Potenzial von Retail Media verstanden und werden ihre Kooperationen zukünftig auch auf Marken und Inhalte ausweiten, die nicht mit ihrer eigenen Produktpalette in direkter Verbindung stehen. Die Aufnahme dieser nicht-endemischen Brands in die eigene Retail-Media-Strategie führt dabei nicht nur zu höheren Umsätzen, sie nutzt auch bestehende strategische Verbindungen. So könnten beispielsweise Autohäuser Anzeigen für Versicherungen schalten oder Videospielehersteller Werbekooperationen mit Energy-Drink-Marken eingehen.
- Der Markt will neue Formate. Die Zeiten simpler Bannerwerbung auf Webseiten sind vorbei, die große Nachfrage nach interaktiven Rich-Media-Angeboten nimmt stetig zu und wird zu einer Erweiterung des Portfolios von unterschiedlichen Formaten führen. Neben Video- und Audio-Inhalten wird dabei vor allem die Interaktion mit den Kunden über Social-Media-Kanäle eine große Rolle spielen.
- Marken setzen auf ganzheitliche Strategie. Ladengeschäfte stellen einen konzentrierten Sammelpunkt der relevanten Zielgruppe dar, weshalb sich immer mehr Marken für einen holistischen Retail-Media-Ansatz entscheiden, der neben On- und Off-Site auch Produktplatzierungen in physischen Läden beinhaltet. Während Ladenbetreiber mit der Vermietung von Werbeflächen und Bildschirmen eine konstante Einnahmequelle erschließen, komplettieren Werbetreibende einen lückenlosen Kreislauf an Online- und Offline-Maßnahmen, um zielgerichtet das richtige Publikum anzusprechen.
- KI treibt das Wachstum von Retail Media voran. Mit Künstlicher Intelligenz steht Retailern und Markenherstellern ein leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung, um mit effizient genutzten Kundendaten ihre Kampagnen präziser auszurichten, Websites zu optimieren und Analysen zu erstellen. Ein Trend, der 2024 verstärkt in den Fokus rücken wird, ist der Einsatz von KI für Prognosen – etwa zur Identifikation von Nutzungsmustern, zur Vorhersage von Kundenverhalten und zur passgenauen Ansprache von Zielgruppen. In Verbindung mit dem Einsatz generativer KI zur schnelleren Erstellung personalisierter Werbung wird dieses KI-gestützte Targeting Unternehmen in die Lage versetzen, die richtigen Kunden zur richtigen Zeit anzusprechen.
- Retail-Media-as-a-Service gewinnt an Bedeutung. Retail Media boomt – und während viele Unternehmen mit Inhouse-Lösungen versuchen, einen möglichst großen Mehrwert für sich herauszuziehen, erreichen nicht wenige dabei schnell ihre Grenzen. Die Zusammenarbeit mit spezialisierten Anbietern von Retail-Media-Plattformen wird 2024 auch deswegen zunehmen, weil die für die Steuerung komplexer Strategien benötigten Tech-Stacks und Analysen bereits auf dem Markt bestehen. Aber auch die notwendige Expertise zur strategischen Planung und Umsetzung von erfolgreichen Kampagnen wird dazu führen, dass sich mehr und mehr Unternehmen für Retail-Media-as-a-Service entscheiden.
„Wir sehen riesige Fortschritte im Bereich Retail Media, die vor allem angetrieben von Künstlicher Intelligenz völlig neue Möglichkeiten bieten“, sagt Alban Villani, Regional CEO EMEA bei CitrusAd. „Retailer und Werbetreibende haben das bisher ungenutzte Potenzial von ganzheitlichen Retail-Media-Strategien erkannt. Auch deswegen wird 2024 ein spannendes Jahr, denn angesichts der neuen Technologien und strategischen Konzepte verspricht die Zukunft Großes – bisher haben wir nur an der Oberfläche gekratzt.“
Weitere Informationen unter citrusad.com
Aufmacherbild / Quelle / Lizenz
Foto von Kindel Media: https://www.pexels.com/de-de/foto/marketing-hand-notizen-tisch-7688440/

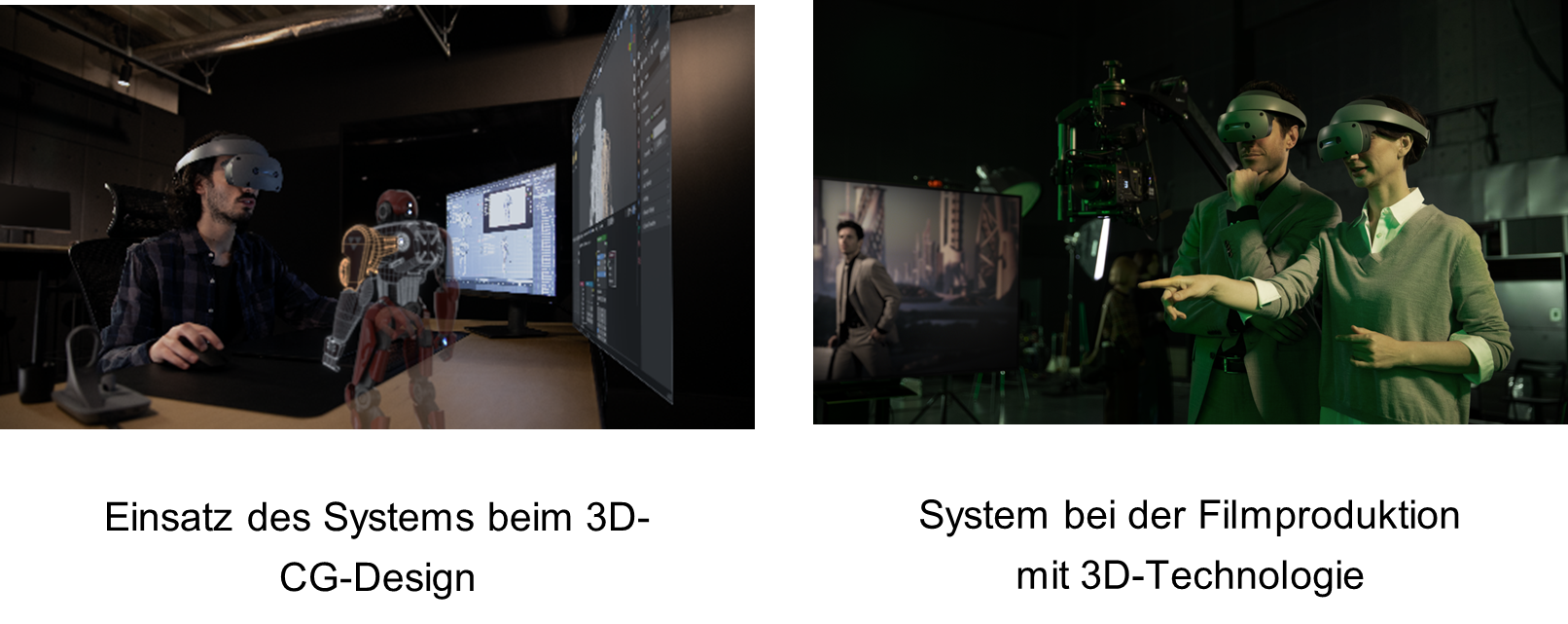
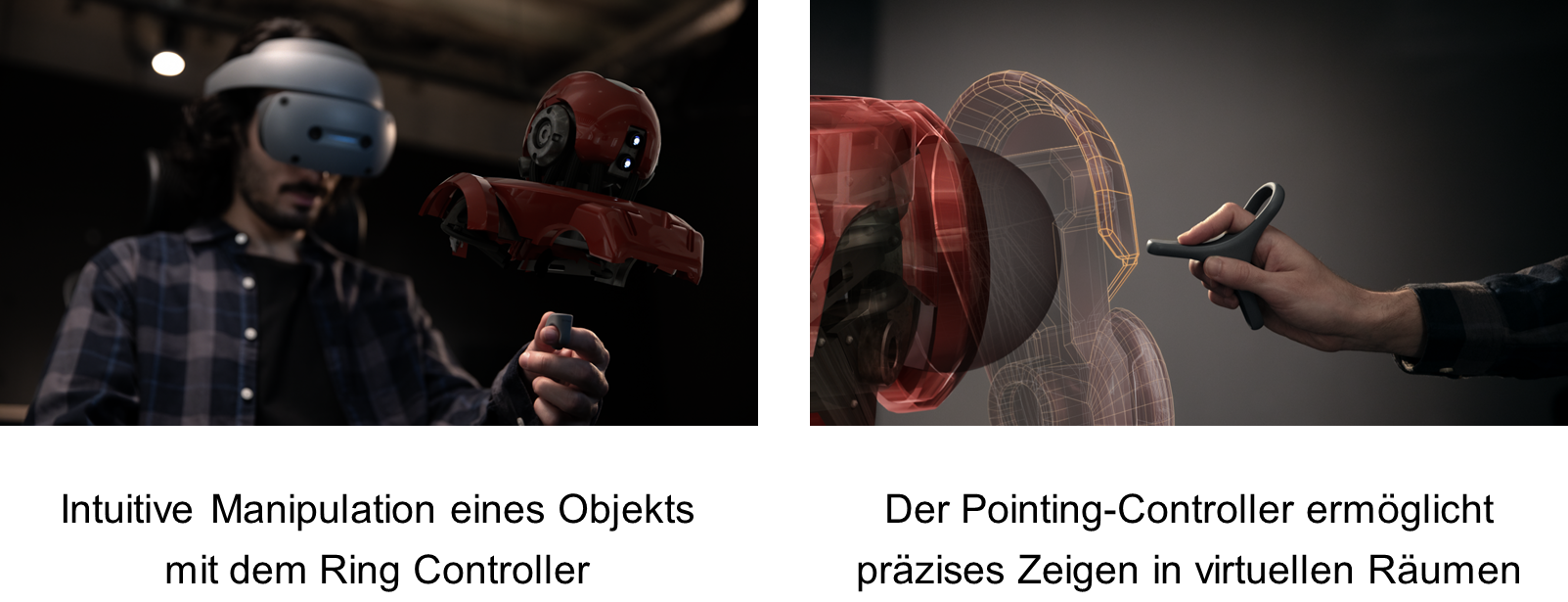
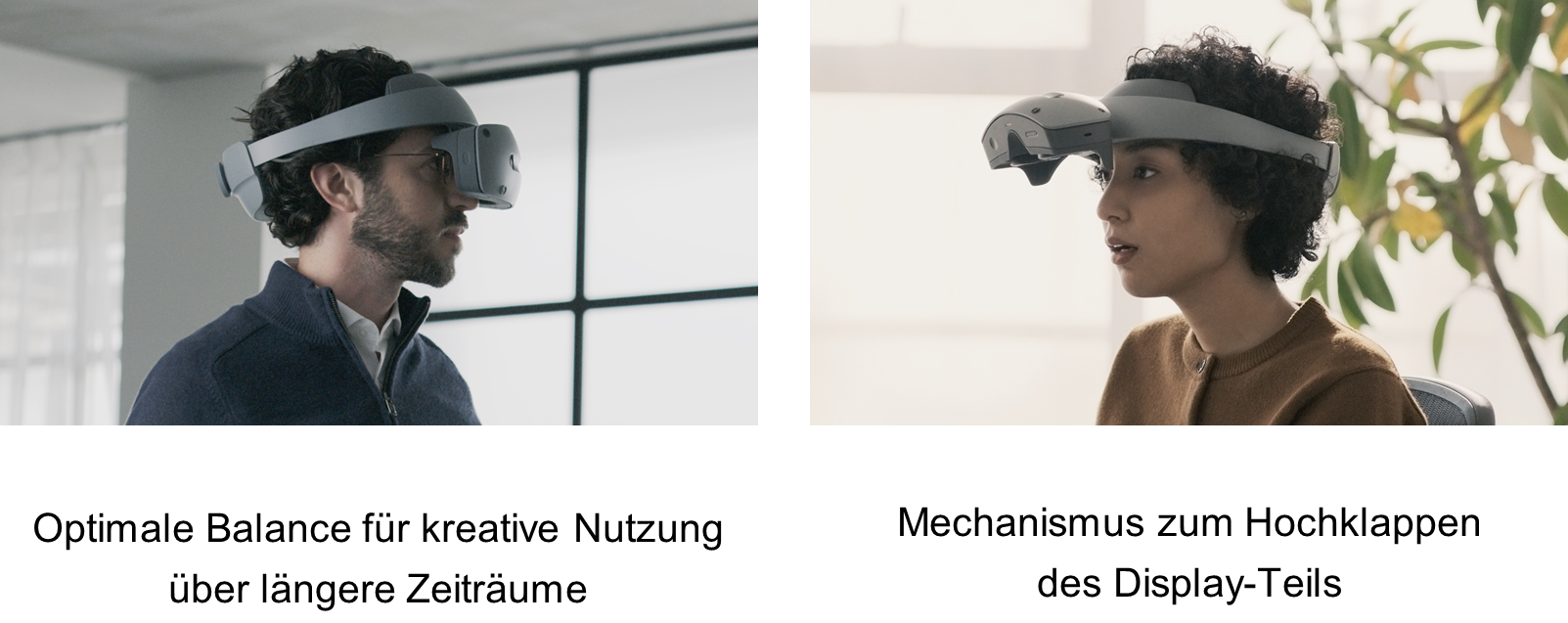

 KI-Experte Carsten Kraus
KI-Experte Carsten Kraus 
 Lukas Schmitz ist CEO der Pagopace GmbH und Experte in den Bereichen Unternehmensaufbau und Contactless Payment. Das Produkt der Firma, der „Pago“, ist ein Ring, mit dem man kontaktlos bezahlen kann und der weder Akku noch Batterie benötigt.
Lukas Schmitz ist CEO der Pagopace GmbH und Experte in den Bereichen Unternehmensaufbau und Contactless Payment. Das Produkt der Firma, der „Pago“, ist ein Ring, mit dem man kontaktlos bezahlen kann und der weder Akku noch Batterie benötigt. 

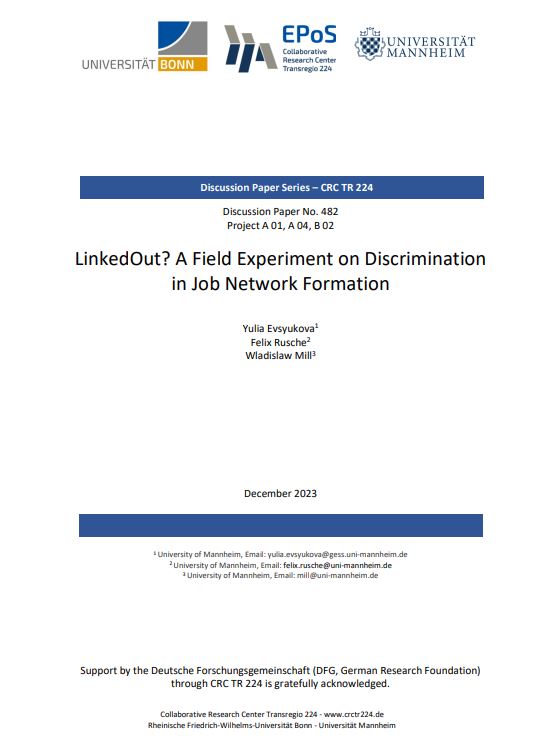 Das vorgestellte Diskussionspapier ist eine Publikation des Sonderforschungsbereichs (SFB) Transregio 224 EPoS.
Das vorgestellte Diskussionspapier ist eine Publikation des Sonderforschungsbereichs (SFB) Transregio 224 EPoS.