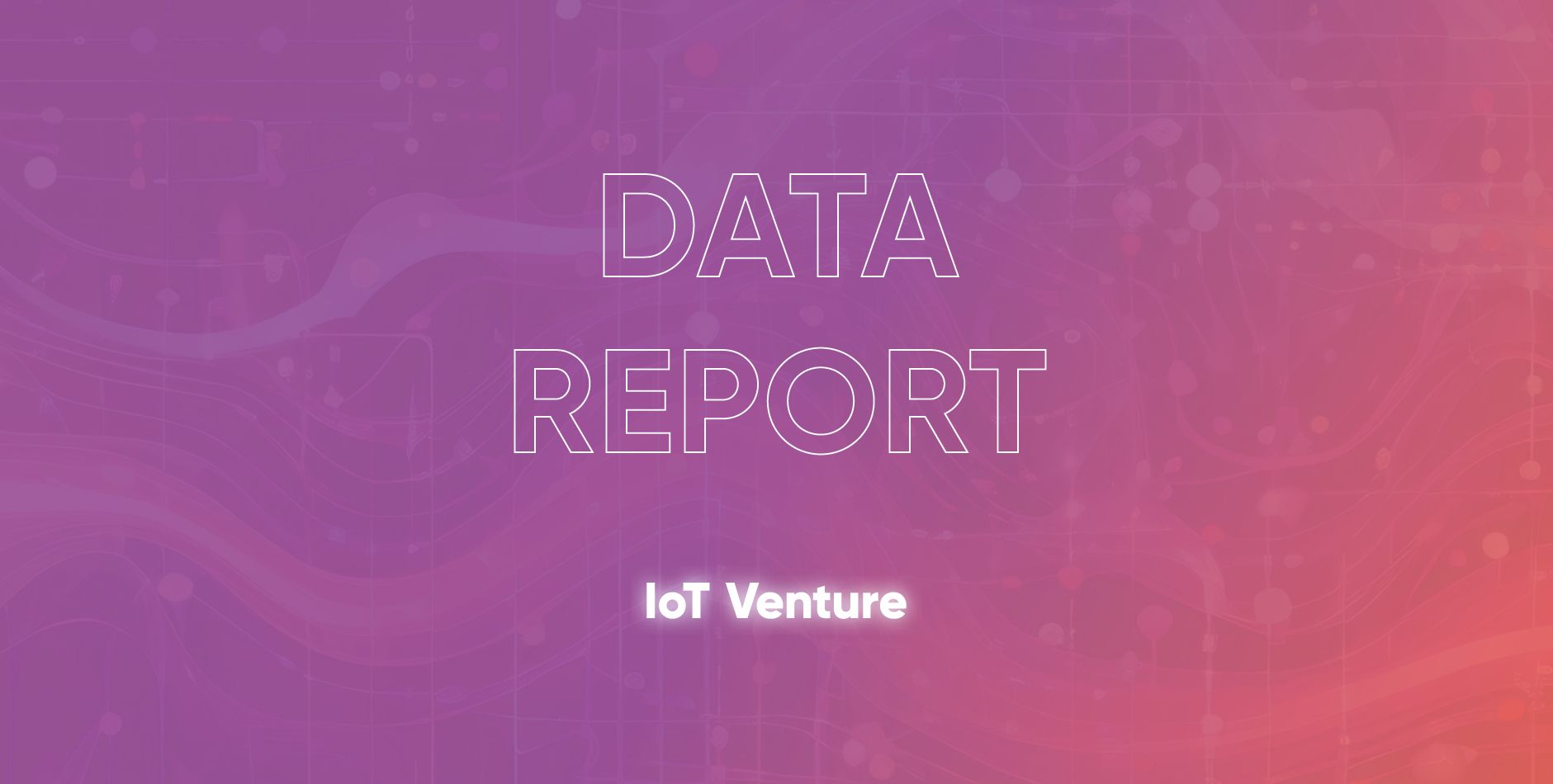Langzeitstudie zur Untersuchung der Social-Media-Kommunikation von B2B-Unternehmen
Einzige Langzeitstudie zur Untersuchung der Social-Media-Kommunikation von B2B-Unternehmen geht im 14.ten Jahr wieder an den Start
Status Quo und alle wesentlichen Trends werden aktuell erhoben -erstmals Untersuchung über KI-Einsatz
Soeben ist die einzige Langzeitstudie zur Untersuchung der Social-Media-Kommunikation von B2B-Unternehmen gestartet.

In 2024 wird nicht nur der aktuelle Status Quo bestimmt, sondern auch erstmals Auswirkungen moderner KI-Technologien auf die Social-Media-Nutzung untersucht. Die Ergebnisse der diesjährigen Studie sind allein schon aus diesem Blickwinkel besonders interessant, denn ChatGPT, Bing, Copilot und andere KI-Lösungen revolutionieren gegenwärtig das gesamte Spektrum der Informationsbeschaffung, der Content-Kreation und beeinflussen vielfältige Kommunikationsaufgaben und -tätigkeiten. Und das in einer deutlich kontroversen Diskussion hinsichtlich Nutzung und Auswirkung auf Berufsbilder. Insgesamt geben die Ergebnisse und Vergleichsmöglichkeiten der Studie Unternehmen aller Branchen und Größenordnung wertvolle Orientierung und Entscheidungshilfen für ihre Budget- und Strategieplanung.
Die Studie untersucht die Veränderungen, die sich im Nutzerverhalten der Social-Media-Kanäle in der B2B-Branche ergeben haben. Gerade das Alleinstellungsmerkmal eines Datenvergleichs über den Zeitraum von nun schon 14 Jahren hinweg, bietet Kommunikationsentscheidern von B2B-Unternehmen im DACH-Raum die einmalige Möglichkeit, nicht nur ihr eigenes Social-Media-Nutzungsverhalten konkret zu analysieren und mit anderen Branchenmitgliedern oder Unternehmen gleicher Größe, Führungskultur oder anderen relevanten Kriterien zu vergleichen. Vielmehr zeigt die Studie, wie und wo man sich mit dem richtigen Kommunikationsmix von Wettbewerbern abzugrenzen, Trends sowie Entwicklungen auf Grundlage valider Datenauswertung richtig einordnen und umsetzen kann.
Die weitreichenden Nutzungsmöglichkeiten und praxisnahen Erkenntnisse bieten für den gesamten deutschsprachigen Raum nicht nur die Möglichkeit, Social-Media-Strategien und -Budgets zielgruppengenau anzupassen. Die Schlussfolgerungen ermöglichen es Kommunikationsentscheidern auch, sich in den sozialen Online-Netzwerken durch passgenaue und glaubwürdige Auftritte von Mitbewerbern zu unterscheiden.
Neu in der diesjährigen Studien-Ausgabe ist der Erhebungskomplex, wie sich gängige und bereits mit großem Hype in Business- und Kommunikationsalltag etablierte KI-Lösungen wie ChatGPT, Copilot, Jasper Chat, Creater Chat oder Chat Sonic, um nur einige Beispiele zu nennen, in Social Media Einsatz und Nutzung abbilden. Und natürlich auch, welche Erwartungen hinsichtlich künftiger Nutzung, Weiterentwicklung, Ressourcen und Budgetaufwand bestehen.
„Wir sehen deutlich, dass die strategische Planung für eine erfolgreiche Social Media Kommunikation immer wichtiger wird.“
Jacqueline Althaller, Herausgeberin der Studie und Kommunikationsexpertin
Folgende Schlüsselfragen stehen für die Langzeitstudie des „Erster Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation“ daher auch in diesem Jahr im Fokus:
- Wie hat sich die Social Media Nutzung im vergangenen Jahr weiterentwickelt?
- Welche Trends und Entwicklungen zeichnen sich nun ab oder etablieren sich?
- Welche Erwartungen stellt die B2B-Community an ihre Social Media Präsenz?
Rückblickend auf die Ergebnisse des letzten Jahres erläutert Jacqueline Althaller, Herausgeberin der Studie und Kommunikationsexpertin: „Wir sehen deutlich, dass die strategische Planung für eine erfolgreiche Social Media Kommunikation immer wichtiger wird. Dafür haben sich die Kanäle, Ressource und Budgets mittlerweile eingependelt. Es wird nun spannend zu sehen, wie sich die Unterschiede hinsichtlich Unternehmensgröße, Branchenzugehörigkeit oder beispielsweise der Unternehmenskultur in den neuen Studienergebnissen weiter manifestieren. Mit Hilfe von erfahrenen und medienaffinen Studienpartnern wollen wir unsere Teilnehmerzahlen in diesem Jahr noch einmal deutlich steigern und freuen uns über jeden, der sich aktiv beteiligt!“
 Die Kooperation mit der »OBSERVER« GmbH hebt das Potenzial noch einmal deutlich für Österreich an. Wie auch im letzten Jahr wird die Studie in der Schweiz durch die KünzlerBachmann Directmarketing AG unterstützt.
Die Kooperation mit der »OBSERVER« GmbH hebt das Potenzial noch einmal deutlich für Österreich an. Wie auch im letzten Jahr wird die Studie in der Schweiz durch die KünzlerBachmann Directmarketing AG unterstützt.
Die Datenerhebung für den gesamten DACH-Raum läuft bis zum 1. August. „Mit der Teilnahme an der Online-Umfrage über diesen Link sichern Sie sich rechtzeitig für Ihre Strategie- und Budgetplanung Ihrer Social Media Kommunikation den kostenlosen Erhalt der Management Summary in Q3/ 2024 “, ergänzt Althaller abschließend.
Über den Ersten Arbeitskreis für Social Media in der B2B-Kommunikation:
Im Sommer 2010 wurde der „Erste Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation“ von Jacqueline Althaller, Gründerin der gleichnamigen Agentur ALTHALLER communication ins Leben gerufen, um konkrete Fragestellungen von Seiten B2B zu beantworten und dieses Wissen auch weiterzuvermitteln. Umfragen führt der Arbeitskreis jährlich durch, um Trends und Entwicklungen in der Social Media Kommunikation feststellen zu können. Zu den Mitgliedern gehören Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größenordnungen – von IT bis Healthcare. Begleitet wird der Arbeitskreis von Vertretern aus Wissenschaft und Forschung. Der Arbeitskreis verfolgt keine wirtschaftlichen Interessen.
Aufmacherbild / Quelle / Lizenz
Image by Biljana Jovanovic from Pixabay



 „Die Ergebnisse der Befragung unterstreichen die Notwendigkeit, das Bewusstsein und das Verständnis für Generative KI in der deutschen Wirtschaft weiter zu schärfen,“ sagt Eva Werle, Vizepräsidentin des BVDW. „Die kontinuierliche Aufklärungsarbeit und den Dialog zwischen den Akteuren der digitalen Wirtschaft gilt es zu fördern, um Deutschland als Standort für digitale Innovationen zu stärken.“
„Die Ergebnisse der Befragung unterstreichen die Notwendigkeit, das Bewusstsein und das Verständnis für Generative KI in der deutschen Wirtschaft weiter zu schärfen,“ sagt Eva Werle, Vizepräsidentin des BVDW. „Die kontinuierliche Aufklärungsarbeit und den Dialog zwischen den Akteuren der digitalen Wirtschaft gilt es zu fördern, um Deutschland als Standort für digitale Innovationen zu stärken.“ Prof. Dr. Felix Weißmüller von der Hochschule der Medien Stuttgart bietet zusammen mit Sebastian Fetz (Perelyn) Studierenden Praxisseminare im Bereich der Künstlichen Intelligenz an. Gemeinsam haben sie im Rahmen eines solchen Seminars die Zusammenarbeit zur Studie initiiert. Weißmüller sagt: „Dieses Projekt illustriert das enorme Potenzial, das in der Verknüpfung akademischer Forschung mit praxisorientierten Anwendungen liegt.”
Prof. Dr. Felix Weißmüller von der Hochschule der Medien Stuttgart bietet zusammen mit Sebastian Fetz (Perelyn) Studierenden Praxisseminare im Bereich der Künstlichen Intelligenz an. Gemeinsam haben sie im Rahmen eines solchen Seminars die Zusammenarbeit zur Studie initiiert. Weißmüller sagt: „Dieses Projekt illustriert das enorme Potenzial, das in der Verknüpfung akademischer Forschung mit praxisorientierten Anwendungen liegt.”