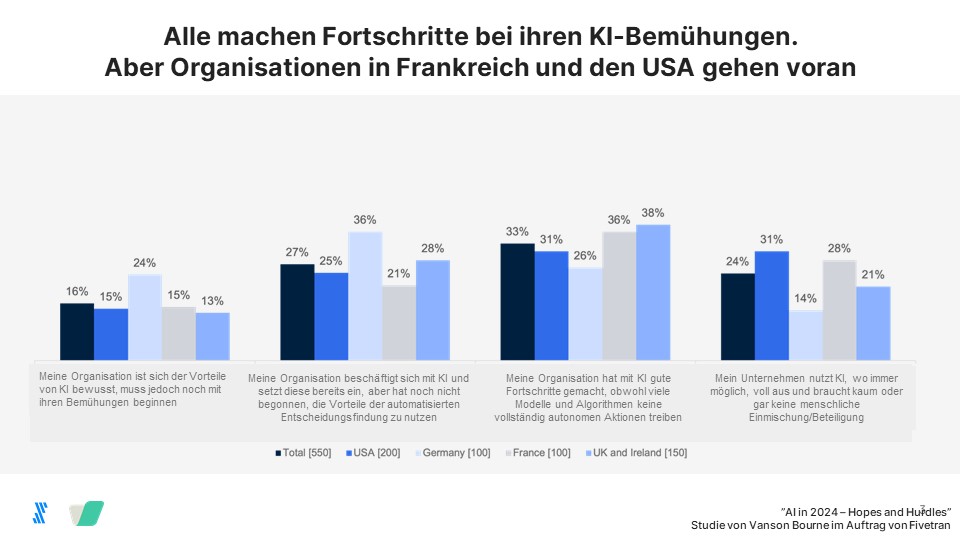Fleischverzehr der Deutschen sinkt 2023 auf Tiefststand
/in Gesundheit, Nachhaltigkeit, Pressemitteilungen/von Bernhard HaselbauerIFAT 2024: Die Wasser-Themen unserer Zeit im Visier
/in Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Pressemitteilungen, Smart Citys, Unternehmen & Märkte, Veranstaltungen und Messen/von Daniela HaselbauerOb Klimaresilienz, Chancen der Digitalisierung, optimierte Abwasserreinigung oder globale Wassergerechtigkeit – die Umwelttechnologiemesse IFAT Munich 2024 ist erneut ein Spiegel aktueller Themenfelder der Wasser- und Abwasserwirtschaft.
- Wege zur Schwammstadt
- Neue EU-Richtlinie gibt Marktimpulse
- Digitale Transformation gestalten
Die Umwelttechnologiemesse IFAT Munich wird vom 13. bis 17. Mai 2024 erneut zeigen, welche Herausforderungen und Marktimpulse die internationale Wasser- und Abwasserwirtschaft derzeit bewegen. Zu den diesjährigen Leitthemen der Münchner Branchenschau gehören die Anpassungen an die Folgen des Klimawandels. Im Veranstaltungsprogramm der Messe finden sich dazu gleich mehrere Termine, die Teilaspekte aus dieser drängenden gesellschaftlichen Aufgabe aufgreifen. Beispielsweise richten die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfälle e.V. (DWA), der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) und der Verband kommunaler Unternehmen am 16. Mai ab 09:30 Uhr den „Tag der resilienten Kommunen“ aus. Dessen Vorträge und Podiumsdiskussionen finden auf der Blue Stage – einer Bühne eigens für Wasserthemen – in der Halle B2 statt.
Bausteine für Schwammstädte
Für mehr Klimaresilienz sind Städte und Gemeinden unter anderem aufgefordert, mit den Auswirkungen von zunehmenden und verschärften Trockenphasen und Starkniederschlägen zurechtzukommen. Ein hoffnungsvolles Konzept hierfür ist die wasserbewusste Stadt, auch als Schwammstadt bezeichnet. Für deren Umsetzung liefern IFAT-Aussteller hilfreiche Bausteine. Beispiele sind die Baumrigole ViaTree der Mall GmbH aus Donaueschingen, das Rigolensystem EcoBloc der Otto Graf GmbH aus Teningen und die Regenwasserbehandlungsanlage Stormclean der ACO GmbH aus Büdelsdorf.
Europäische Kommunalabwasserrichtlinie umsetzen
Eine bedeutende marktgestaltende Wirkung können ferner neue gesetzliche Vorgaben haben – namentlich auf EU-Ebene. Ein aktuelles Beispiel ist die Europäische Kommunalabwasserrichtlinie. Diese wurde nach über 30 Jahren umfassend überarbeitet, der Kompromiss aus Brüssel liegt nun vor. „Die dabei vorgesehenen Veränderungen werden einen erheblichen Einfluss auf die Abwasserbehandlung in Europa haben, insbesondere für die Entfernung von anthropogenen Spurenstoffen, bei der Steigerung der Energieeffizienz und Eigenenergieerzeugung auf kommunalen Kläranlagen oder für die Behandlung von Mischwasser“, betont DWA-Präsident Prof. Dr. Uli Paetzel. Vor diesem Hintergrund veranstaltet die Vereinigung am 14. Mai um 16:30 Uhr auf der Blue Stage eine Session, bei der Entwicklungen und Entscheidungen zur Umsetzung der Kommunalabwasserrichtlinie unter rechtlichen, technischen und betrieblichen Gesichtspunkten erläutert und diskutiert werden.
Auch auf Seiten der Aussteller widmet man sich den anspruchsvolleren Anforderungen. So präsentiert die Huber SE aus Berching unter anderem den neu entwickelten Tuchfilter RotaFilt. Dieser scheidet feine suspendierte Stoffe wie Schlammflocken und Mikroplastik zuverlässig ab und entfernt Phosphor per Flockungsfiltration. Und die ProMinent GmbH aus Heidelberg zeigt, wie Mikroschadstoffe wie Medikamentenrückstände mit Ozon beseitigt werden und wie die Ozonerzeugung mit modularen Anlagen besonders wirtschaftlich betrieben wird.
Wohin führt die Digitalisierung?
Auch in der Wasser- und Abwasserwirtschaft ist die digitale Transformation in vollem Gange. Der Münchner Branchentreff gibt in selten verfügbarer Breite Antworten auf Fragen wie: Wo stehen wir in diesem Prozess? Welche Chancen und Risiken sind damit verbunden? Wohin kann in Zukunft die digitale Reise gehen? Räumlich verdichtet findet sich dieses Fokusthema in der Spotlight Area „Digitalisierung in der Wasserwirtschaft“ am Eingang West des Münchener Messegeländes. Auf dem von der DWA organisierten Sonderausstellungsbereich direkt hinter den Verbändeständen stehen Best-Practice-Lösungen im Mittelpunkt. Unter anderem präsentiert der DVGW dort das Projekt „Quelle der Zukunft. Wasser für Generationen“. Hierbei will die Bodensee-Wasserversorgung mit neuen Anlagen die Trinkwasserversorgung von rund vier Millionen Menschen auch für die nächsten Jahrzehnte sicherstellen. Die Besucherinnen und Besucher können durch Augmented Reality in die Anlagen visuell eintauchen und die Anwendung digitaler Techniken erleben.
Raum für zukunftsweisende digitale Entwicklungen bietet nicht zuletzt die lokale Hochwasser-Frühwarnung. Am Stand des Unternehmens Endress + Hauser aus Weil am Rhein können sich Interessierte dazu über das System Netilion Flood Monitoring informieren. Bei diesem hilft Künstliche Intelligenz, auf der Grundlage von vor Ort durch Pegelmessgeräte sowie Regen- und Bodenfeuchtsensoren erhobenen Daten – verknüpft mit Wettervorhersagen und Informationen zur Geländebeschaffenheit – Hochwasserlagen frühzeitig und präzise einzuschätzen. Digitale Zwillinge gehören zur den Schlüsselkonzepten der Industrie 4.0 – auch in der Wasserwirtschaft. So demonstriert die Siemens AG aus Erlangen auf der Messe ein solches virtuelles Modell, das den gesamten Anlagenlebenszyklus abbildet. Mit diesem lassen sich schlanke Prozesse realisieren – vom Design und Engineering über Betrieb und Instandhaltung bis hin zur Optimierung.
Wassergerechtigkeit für eine harmonischere Welt
Wasser hat auch eine geopolitische Dimension – heute vielleicht mehr denn je. So kann es bei Wassermangel oder ungleicher Verteilung des blauen Goldes zu regionalen oder nationenübergreifenden Spannungen kommen. Faktoren, wie der fortschreitende Klimawandel, die wachsende Weltbevölkerung oder auch kriegerische Auseinandersetzungen, verschärfen die Situation. Im Umkehrschluss hat eine gerechte und nachhaltige Wassernutzung das Potenzial, ein harmonisches Zusammenleben auf allen Ebenen zu fördern. Nicht von ungefähr stand der diesjährige Weltwassertag am 22. März unter dem Motto „Wasser für Frieden“. „Viele Technologien und Systeme unserer Aussteller können als Beiträge zu mehr globaler Wassergerechtigkeit und damit zu mehr Frieden gesehen werden“, sagt Philipp Eisenmann, Exhibition Director der IFAT Munich. Wie zum Beispiel das mobile, palettengroße Wasseraufbereitungssystem PurAID des Herstellers Pureco aus Budpest/Ungarn. Das kostengünstige, modulare System eignet sich für die Wasserversorgung in ländlichen und abgelegenen Gebieten. Es entfernt Arsen, Eisen, Mangan, Ammoniak, Fluor, Bakterien und Viren aus Grundwasser, Brunnenwasser und bereits vorhandenem, aber verschmutztem Netzwasser. Im Veranstaltungsprogramm widmen sich unter anderem die European Water Association (EWA) und die International Water Association (IWA) diesem Themenkreis: Am 14. Mai um 14:30 Uhr organisieren sie gemeinsam auf der Blue Stage die Podiumsdiskussion „Invest in Water – Invest in Security“. „Wir haben internationale Akteure eingeladen, über ihre Maßnahmen und Erfahrungen bei der weltweiten Unterstützung des Wassersektors zu berichten, die darauf abzielen, Sicherheit und Frieden zu fördern“, schildert EWA-General-Sekretär Johannes Lohaus.
Weitere Informationen zur IFAT Munich finden Sie auf: www.ifat.de
Aufmacherbild: Bild von kalhh auf Pixabay
Kommunikationslücken zwischen CISO und Top-Management
/in Allgemein, Studien/von Martina Bartlett-MattisUnternehmen fokussieren sich zunehmend auf Cybersicherheit – Zugleich zeigt Studie von FTI Consulting erhebliche Kommunikationslücken zwischen Chief Information Security Officer (CISO) und Top-Management auf
Fehlende Kommunikation als Risikofaktor: In Führungsetagen geht mehr als jeder dritte Befragte davon aus, dass Cybersicherheits-Verantwortlic
Zwischen Top-Management und Cybersicherheits-Verantwortlic
Angesichts einer sich rasch entwickelnden Risikolandschaft, neuer gesetzlicher Vorschriften und erhöhter öffentlicher Aufmerksamkeit investieren Top-Manager vermehrt in Cybersicherheit. Zugleich sind viele aber der Meinung, dass ihre CISOs wichtigen, sicherheitsrelevanten Kommunikationsanforderungen nicht gerecht werden.
„Keine Frage, Top-Management und CISOs sind sich der Bedeutung von Cybersicherheitsrisiken bewusst“, sagt Meredith Griffanti, Global Head of Cybersecurity & Data Privacy Communications bei FTI Consulting. „Dennoch müssen Unternehmen noch mehr tun, damit Manager und CISOs auch die gleiche Sprache sprechen.“
Im Rahmen der CISO-Studie wurden knapp 800 C-Level-Manager aus neun Ländern und sieben Industrien befragt. Der Studie zufolge wünschen sich nahezu die Hälfte (45%) der befragten deutschen Führungskräfte von ihren CISOs die Fähigkeit, Fachjargon in verständliche Sprache zu übersetzen. Die Risiko-Dimension verdeutlicht ein weiteres Ergebnis der Studie: Darin gaben nur 2% der befragten deutschen CISOs an, dass ihre Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten keinen Cyberangriff erlebt hatten.
„Sicherheit ist das gemeinsame Ziel von CISOs und Top-Management. Doch unsere Studie zeigt, dass sie häufig aneinander vorbei kommunizieren“, sagt Hans-Peter Fischer, Senior Managing Director und Leiter des Bereichs Cyber Security bei FTI in Deutschland. Schließlich spricht der CISO einen Fachjargon, den die Führungsebene und der Vorstand oft nicht verstehen. So entsteht leicht ein endloser Kreislauf, in dem der CISO versucht, die Dinge einfacher – oder besser – darzustellen, als sie tatsächlich sind. „Das wiederum kann dazu führen, dass zum einen CISOs ihr Management von gewissen Investitionen nicht oder nur schwer überzeugen können. Und zum anderen der Vorstand kein genaues Bild hat, wo das Unternehmen am anfälligsten ist,“ so Hans-Peter Fischer weiter. Die Schulung der Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten von CISOs ist somit von entscheidender Bedeutung für ein gemeinsames Verständnis und die richtige Priorisierung von Cybersicherheitsthemen im Unternehmen. Neben einem besseren Verständnis wünschen sich deutsche Vorstandsvertreter aber auch eine bessere Verankerung des Themas in der Unternehmenskultur, um Risiken im Bereich Informations- und Cybersicherheit zu reduzieren. So sehen 28% der Befragten in Deutschland Trainingsbedarf zur Frage, wie eine proaktive und adaptive Cybersicherheits-Kultur geschaffen werden kann.
Die befragten deutschen Unternehmen besorgt am meisten das unzureichende Verständnis von Informationssicherheits- und Cybersicherheitsrisiken der Mitarbeiter (45%). Die Schwierigkeit, die richtigen Talente im Bereich Cybersicherheit und Datenschutz zu finden (41%) rangiert auf Rang 2 der Sorgen-Skala.
Der Studie zufolge sind 94 % der befragten Top-Manager der Meinung, dass das Thema Cybersicherheit in den letzten 12 Monaten an Bedeutung gewonnen hat. Bei der Mehrheit genießt Cybersicherheit eine hohe Priorität. Das Top-Management stellt finanzielle Mittel bereit, um dieser neuen Realität Rechnung zu tragen. Durchschnittlich wollen sie Cybersicherheitsbudgets in den kommenden ein bis zwei Jahren um etwa ein Viertel (23%) und in den nächsten drei bis fünf Jahren um mehr als ein Drittel (36%) erhöhen.
Die zentralen Ergebnisse der „CISO Redefined“-Reihe bestätigen eine Kommunikations-lücke zwischen Top-Management und CISOs:
- Bemerkenswerte 66% der CISOs sind der Meinung, dass die oberste Führungsebene Schwierigkeiten hat, ihre Rolle innerhalb des Unternehmens vollständig zu verstehen. 31% der C-Level-Führungskräfte wiederum haben Schwierigkeiten, den konkreten Nutzen von Cyber-Investitionen nachzuvollziehen.
- Während 82% der CISOs ein Bedürfnis verspüren, die Sachlage gegenüber dem Vorstand besser darzustellen, glauben 31% der Top-Manager, dass ihre CISOs ein positiveres Bild zeichnen, als es der Wirklichkeit entspricht. 30% denken, dass die CISOs sich nur zögerlich über Sicherheitsbedenken äußern.
- Was interne Abstimmungen betrifft, bestätigen 58% der CISOs, dass es ihnen schwer fällt, den Fachjargon für die Führungsebene verständlich zu übersetzen. 28% der Top-Führungskräfte sind der Studie zufolge zugleich der Meinung, dass es ihre CISO vor Herausforderungen stellt, technische Begriffe in betriebswirtschaftliche Begriffe zu übersetzen. 30% berichten von diesem Problem, wenn CISOs Cyber-Risiken in finanziellen und materiellen Kategorien verständlich machen sollen.
- 98% der befragten Top-Manager sprechen sich dafür aus, mehr Mittel für Kommunikations- und Präsentationstrainings für CISOs bereitzustellen, wobei fast die Hälfte diesen Bedarf als dringend bezeichnet.
„Klare, offene Kommunikation im Führungskreis ist ein Muss für jedes Unternehmen, um die gestiegenen Risiken im Bereich der Cybersicherheit angemessen zu bewerten und sich dagegen zu schützen,“ sagt Oliver Müller, Senior Managing Director und Leiter des Bereichs Krisen-, Litigation- und Cybersicherheitskommunikation bei FTI Deutschland. „Wenn Führungskräfte keinen Einblick in die Bedrohungen haben, mit denen sie konfrontiert sind, verpassen Unternehmen die Möglichkeit, die richtigen Ressourcen einzusetzen, um ihre Widerstandsfähigkeit und Abwehrbereitschaft zu maximieren.“
Die vollständige Untersuchung können Sie hier herunterladen:
https://fticommunications.com/ciso-redefined-navigating-c-suite-perceptions-and-expectations/
Methodik der Umfrage
FTI Consulting’s Digital & Insights Practice führte im November 2023 eine Online-Umfrage unter 787 C-Suite-Führungskräften in Organisationen mit mehr als 500 Mitarbeitern aus den Schlüsselindustrien von FTI durch, welche Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 21,5 Billionen US-Dollar und 3,69 Millionen Mitarbeitern weltweit repräsentieren.
Aufmacherbild / Quelle / Lizenz
Image by Gerd Altmann from Pixabay
Neue nachhaltige Ideen…
/in Creative Commons CC BY-ND, Data Science, Digitalisierung, Mobilität, Nachhaltigkeit, Reportagen, Smart Citys, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte/von Daniela HaselbauerDer nachhaltige Boom des globalen Batteriemarktes geht weiter, denn die ganze Welt braucht mobile Energie und Speicher. Allein zwischen 2020 und 2030 wird sich die Nachfrage mehr als verachtzehnfachen, mit einem jährlichen Wachstum von 34 %. Der Hauptgrund für diese Entwicklung ist die Umstellung der Automobilindustrie auf batterieelektrische Fahrzeuge. Dabei greifen rund 80 % der Hersteller auf Lithium-Ionen-Batterien zurück. Zu diesen Ergebnissen kommt die Publikation „Battery Monitor 2023“ von Roland Berger und der RWTH Aachen. Um der langjährigen Erfahrung asiatischer Fabriken entgegenzuwirken, haben in den vergangenen Jahren innovative Produkt- und Prozesstechnologien im Batteriesektor an Bedeutung gewonnen. Infolgedessen ist ein zunehmender Trend zu Patenten aus den USA und Europa festzustellen. Besonders im Bereich der Fertigungstechnologien sind diese Innovationen relevant. Den Unternehmen muss ein erfolgreicher Spagat zwischen einer effizienten, vergleichsweise kostengünstigen und einer nachhaltigen Batterieproduktion gelingen. Nur so können sie mittelfristig in diesem dynamischen Markt ihre Position sichern. Laut der Untersuchung stehen im Fokus der aktuellen Entwicklungen vor allem technische Innovationen für eine effizientere Produktion und alternative Batteriematerialien.
Genau hier setzt auch die innovative Batterietechnologie des Joint-Ventures von Altech Advanced Materials und dem Fraunhofer-Institut IKTS an. Die neue Festkörperbatterie für den stationären Betrieb „Cerenergy“ geht gerade in die Kommerzialisierung. Die neuartige Batterie ist frei von kritischen Rohstoffen wie Kobalt, Grafit und Lithium und benötigt auch kein Kupfer. „Unsere Batterie ist aufgrund der Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit perfekt für den stationären Einsatz in Stromnetzen, bei erneuerbaren Energien und in der Industrie geeignet und besteht lediglich aus Kochsalz, Keramik und Nickel. Sie ist nicht brennbar und behält ihre volle Leistung über den gesamten Lebenszyklus von über 15 Jahren“, erklärte Uwe Ahrens von Altech Advanced Materials im Gespräch mit unserer Redaktion. In diesem Kontext sind quasi Netzspeicherbatterien der Missing Link der Energiewende. Doch es gibt laut Ahrens noch weitere Einsatzfelder, Stichwort E-Mobilität: Wenn jetzt begonnen wird, LKW-Flotten zu elektrifizieren, müssen diese auch schnell geladen werden, ohne dass die Netze bei den Speditionen und den Autohöfen in die „Knie gehen“, da diese nicht in der Lage sind, eine so große Menge Strom in kurzer Zeit zu leiten. „Unsere Batterie ist für diesen Anwendungsfall prädestiniert. Da sie nicht brennbar ist, kann sie ohne sonst erforderliche Sicherheitsabstände in die bestehende Tankinfrastruktur integriert und für die entsprechende Ladeinfrastruktur für den Schwerlastverkehr genutzt werden.“ Mit Blick auf den Klimawandel und die damit verbundene Energiewende, werden in den nächsten Jahren viele globale Herausforderung auf die Gesellschaften zukommen. Einen gemeinschaftlichen und innovativen Weg bietet die All Electric Society Alliance, die sich als Forschungsallianz die Sensibilisierung der Gesellschaft im Kontext der Energiewende und der All Electric Society (AES), auf die Fahne geschrieben hat.
Dazu erklärte uns Prof. Dr.-Ing. Mirko Bodach von der Westsächsischen Hochschule Zwickau: „Die Allianz ist eine offene Anlaufstelle für die All Electric Society. Egal ob Kommune, KMU, global Player, NGO, Energieversorger oder Forschungseinrichtung: Jeder ist eingeladen, mitzuwirken und seine Expertise einzubringen. Denn nur wenn alle an einem Strang ziehen, ist die Realisierung der AES und somit die Bewältigung des Klimawandels möglich.“ Laut Prof. Bodach ist eine fundamentale Grundlage für eine solche Transformation die interdisziplinäre Zusammenarbeit: „Damit meine ich nicht, dass sich unterschiedliche Fachdisziplinen mal eben kurz unterhalten. Es braucht eine tiefgreifendere, verwobene Bearbeitungsstruktur. Nur, wenn alle betreffenden Akteure gemeinsam agieren, kann eine CO2-neutrale Energieversorgung erreicht werden.“ In diesem Kontext stellen sich momentan viele Unternehmen aus energieintensiven Branchen die Frage, wie die Klimaziele der Bundesregierung und der EU erreichbar sind.
Die Energiewirtschaft zum Beispiel, steht vor der enormen Herausforderung, die Energiewende nachhaltig zu finanzieren und gleichzeitig die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Laut einem aktuellen Positionspapier des Verbands kommunaler Unternehmen sowie von Deloitte und dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sind Investitionen im Energiesektor von geschätzt 600 Milliarden Euro erforderlich, um die ambitionierten Ziele der Bundesregierung für das Jahr 2030 zu erreichen. Diese Summe wird bis 2045 voraussichtlich auf mindestens eine Billion Euro ansteigen. Damit geraten die Finanzierungsmöglichkeiten an ihre Grenzen, auch im Hinblick auf die Inflationstendenzen und die aktuelle Zinssituation. Unternehmen müssen sich darauf einstellen, verschiedene Finanzierungsinstrumente und Investorengruppen zu orchestrieren. Sowohl auf der Kapital suchenden als auch auf der Kapital gebenden Seite wird die Finanzierung der Energiewende neue Kompetenzen und einen Kulturwandel abverlangen – unter anderem müssen die Akteure ins Finanzmarkt- und ESG-Reporting einsteigen. Wenn also der Ausbau der erneuerbaren Energien, und der Netzinfrastruktur, der Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft, die Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung sowie die Umgestaltung des Verkehrssektors gelingen sollen, müssen mehr Anreize, Verlässlichkeit und Sicherheiten für alle Beteiligten von der Bundesregierung geschaffen werden. „Um die Transformation insbesondere in den industriellen Sektoren zu unterstützen, sind zum Beispiel sogenannte Carbon Contracts for Difference (CCfD) geplant. Die Bundesregierung arbeitet an entsprechenden Gesetzesvorhaben. Gerade in der Anlaufphase sollen sie das Unternehmensrisiko von Investitionen in treibhausgasarme Produktionsverfahren mindern“, erklärte in diesem Kontext Wolfgang Vitzthum, Director ‚ESG & Sustainable Finance Solutions’, von der Commerzbank. CCfD sind Klimaschutzverträge zwischen Staat und Unternehmen der energieintensiven Industrie. Mit ihnen sollen die Mehrkosten klimafreundlicher Produktionsverfahren gegenüber herkömmlichen Verfahren ausgeglichen werden. Die Energiewende wird ohne eine Beteiligung von uns Bürgern nicht möglich werden. Investitionen in die Sanierung und Wärmedämmung von Gebäuden mit umweltfreundlicher Energie stellen aber jetzt schon viele Familien und Hausbesitzer vor große Probleme. Ab März 2024 hilft nun auch die Bundesregierung mit der Heizungsförderung für Privatpersonen durch die KFW. Ein weiterer wichtiger Baustein für die Energiewende sind Energiegemeinschaften. Innerhalb von Energiegemeinschaften sollen Bürgerinnen und Bürger Strom und Wärme gemeinsam erzeugen, speichern, handeln und nutzen. Dahinter steht eigentlich der Grundgedanke der Genossenschaften und diese haben sich schon beim Ausbau erneuerbarer Energien bewährt. Dass, Energiegemeinschaften en Vogue sind, bestätigt auch Simon Bartmann Co-CEO von Bullfinch. „Hier sehen wir die Zukunft des Marktes und wollen Milliarden in diese Infrastruktur investieren – vergleichbar mit Investitionen in Glasfaser, 5G oder regionale Kraftwerke. Wir verstehen es als unsere Aufgabe die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir die Projektgesellschaft Solarausbau Deutschland gegründet. In den ersten Regionen, wie Norddeutschland, bauen wir bereits erfolgreich die Energie-Infrastruktur der Zukunft. Mit unseren Service Points u. a. in der Stadt Varel rollen wir die Projekte lokal mit hoher Qualität aus.“ Bullfinch begleitet Stadtwerke, Energie-Dienstleister und Installateure beim Einbau und bei der Finanzierung von Solaranlagen, Speichern und Wärmepumpen. Es fehlt vor allem noch an einem gesetzlichen Rahmen, der die Gründung und den Betrieb von Energiegemeinschaften in Deutschland ermöglicht. Wer wissen möchte, wie Energiegemeinschaften funktionieren, kann einen Blick nach Österreich werfen, dort sind die wichtigsten Fragen schon geklärt.
Autor: Bernhard Haselbauer
CC BY-ND 4.0 DE
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#
Sie dürfen:
- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.
Unter den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.
- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.
Aufmacherbild/Quelle/ Lizenz
Quelle: Istock_gremlin
Zero Trust, viel mehr als nur Identität!
/in Creative Commons CC BY-ND, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Sicherheit, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte/von Daniela HaselbauerIlona Simpson, CXO Advisor bei Netskope, schreibt über den Zero-Trust-Ansatz und wie Unternehmen damit Daten nachhaltig schützen und zu mehr Sicherheit gelangen.
Zero Trust ist das neueste Schlagwort in der Cybersicherheit. Obwohl sich der Staub gelegt hat, mangelt es immer noch an einer einheitlichen Vorstellung davon, was jeder unter dem Begriff versteht. Während der Konsens weitgehend positiv ist, dass ein Zero-Trust-Ansatz der richtige Weg ist, um ein Unternehmen und seine Daten zu schützen, gibt es immer noch viele Unklarheiten darüber, wie ein solcher Ansatz aussieht.
Insbesondere scheint es mir zwei grundsätzliche Missverständnisse zu geben. Das erste ist, dass Zero Trust etwas ist, das man kaufen kann. Zero Trust ist keine Software, Hardware oder Cloud-Anwendung, es ist ein Ansatz, ein Ethos. Um eine Zero-Trust-Strategie zu erreichen, arbeiten Sie am besten mit Partnern zusammen, die diese grundlegende Nuance richtig verstehen. Das zweite Missverständnis besteht darin, dass Zero Trust nur die neueste Art ist, die Identitätsmanagementkomponente eines Sicherheitsstapels zu bezeichnen.
Es besteht kein Zweifel daran, dass Identität ein grundlegender Bestandteil eines effektiven Zero-Trust-Ansatzes ist, aber es besteht auch die Gefahr, dass sich Unternehmen so sehr auf dieses eine Element konzentrieren, dass sie vergessen, dass es noch andere gibt.
Diese Fehleinschätzung kann zu potenziellen Schwachstellen führen, die wiederum zu schwerwiegenden Cybersecurity-Ereignissen führen können – genau die Art von Ereignissen, die das Unternehmen durch die Einführung von Zero Trust von vornherein zu vermeiden versuchte.
Seit vielen Jahren nutzen Unternehmen die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), um den Schutz sensibler Daten zu gewährleisten. Die Bedrohungslandschaft entwickelt sich jedoch weiter und einige Experten schätzen inzwischen, dass bis zu 70 % der MFA-Optionen durch Social Engineering und Phishing gehackt werden können. Die Identität ist wichtig, aber es wird immer unzuverlässiger, sich auf sie als Hauptdeterminante in einer Sicherheitsrichtlinie zu verlassen. Außerhalb der Welt der Cybersicherheit würden wir unser Vertrauen nicht auf der Grundlage einer einzigen Beurteilung in jemanden setzen. Vertrauen ist ein vielschichtiger Prozess, der im Laufe der Zeit aufgebaut werden muss. Ebenso muss es mehrere Formen der Verifizierung geben, um Zero Trust zu erreichen. Zero Trust muss mit der Annahme beginnen, dass Ihr System kompromittiert werden kann und wird. Je mehr Schutzmaßnahmen ergriffen werden, desto mehr Vertrauen können wir in sie setzen. Entscheidend ist jedoch, dass ein einziger Punkt zur Durchsetzung von Richtlinien verwendet wird, um den Datenverkehr zu kontrollieren, der von diesen verschiedenen Maßnahmen ausgeht.

Ilona Simpson über „Zero Trust“
Echtes Zero Trust wird nur erreicht, wenn ein Unternehmen einen integrierten, ganzheitlichen Ansatz verfolgt, der jeden Berührungspunkt, Benutzer und jedes Gerät berücksichtigt. Wichtig ist, dass Vertrauensentscheidungen auf der Grundlage dieser detaillierten Erkenntnisse ständig angepasst werden. Durch die Einbeziehung aller acht Elemente in ihren Zero-Trust-Ansatz (einschließlich Identität) können Unternehmen mit weitaus größerem Vertrauen operieren. Damit wird Sicherheit zu einem echten Faktor, der Innovationen und Anpassungen an die Anforderungen des Unternehmens ermöglicht, sei es die Einführung neuer Anwendungen, die Integration von KI, die Expansion in neue Märkte oder die Förderung von Hybridarbeit.
Die Identitätsauthentifizierung ist eine der ersten und am häufigsten verwendeten Maßnahmen für Zero Trust und sollte ein Kernstück jeder Strategie sein. Es gibt sieben weitere Elemente, die Unternehmen in die Durchsetzung ihrer Richtlinien einbauen sollten, um eine wirklich sichere, robuste Zero-Trust-Infrastruktur zu gewährleisten:
- Gerät
Es kommt nicht nur darauf an, welches Gerät Sie verwenden. Auch ein vollständig authentifizierter Benutzer auf einem kompromittierten Gerät stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Zero Trust sollte Firmen- und Privatgeräte unterscheiden und den Gerätezustand, Patch-Level und Sicherheitskonfigurationen prüfen, bevor Zugriff gewährt wird.
- Standort
Mit hybrider Arbeit sollten Unternehmen damit rechnen, dass Nutzer versuchen, von verschiedenen Standorten aus auf Daten und Hardware zuzugreifen.
- App
Sicherheitsteams sollten bestimmte Apps für die Nutzung im Unternehmen überprüfen und genehmigen und ggf. erweiterte Kontrollen und/oder Beschränkungen für nicht genehmigte Anwendungen einführen, um einen möglichen Datenverlust zu verhindern.
- Instanz
Viele Unternehmen erlauben ihren Mitarbeitern die Nutzung ihrer persönlichen Cloud-Anwendungen, etwa persönliche Instanzen von Microsoft 365. Dies kann jedoch zu Problemen führen, insbesondere wenn vertrauliche Unternehmensdaten in einer persönlichen App freigegeben werden. Daher sollte auch jede Instanz jeder App verstanden werden.
- Aktivität
Zero Trust erstreckt sich darauf, wie Anwendungen miteinander interagieren und wie sie auf Daten zugreifen. Selbst innerhalb der Sitzung eines einzelnen Benutzers sollten die Aktionen, die eine Anwendung im Namen dieses Benutzers durchführt, einer genauen Prüfung unterzogen werden.
- Verhalten
Die Identität kann den Nutzern den Erstzugang gewähren, das Verhalten danach sollte kontinuierlich überprüft werden (unter sorgfältiger Beachtung des Datenschutzes der Mitarbeiter). Wenn ein Mitarbeiter (oder eine Organisation) plötzlich auf große Datenmengen zugreift oder sensible Dateien herunterlädt, sollten die Alarmglocken läuten, selbst wenn der Benutzer ursprünglich authentifiziert war.
- Daten
Das Herzstück von Zero Trust sind Daten – es geht darum, die Integrität und Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten. Das bedeutet, Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung zu verschlüsseln und dass Datenzugriffsmuster auf Anomalien überwacht werden müssen.
CC BY-ND 4.0 DE
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#
Sie dürfen:
- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.
Unter den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.
- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.
Sicherer und verantwortungsvoller Einsatz von KI
/in Creative Commons CC BY-ND, Digitalisierung, Freie Inhalte, Künstliche Intelligenz, Sicherheit, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte/von Daniela HaselbauerIm Interview erklärt Philipp Adamidis, CEO und Mitgründer von QuantPi, wie seine Plattform den sicheren, verständlichen und effizienten Einkauf sowie Einsatz von KI für Organisationen ermöglicht.
Herr Adamidis, wie wird aus KI eine vertrauenswürdige KI?
Damit KI vertrauenswürdiger wird, müssen wir sie vor allem verständlich und nachvollziehbar machen. Stellen Sie sich etwa eine KI-gestützte App vor, die Hautkrebs erkennt. Vertrauen entsteht, wenn unter anderem Nutzer wissen, woher die Trainingsbilder stammen, z. B. von Dermatologen, und dass sie vielfältig sind –verschiedene Hautfarben, Alter– etc. Zudem sollte die App erklären, warum sie ein Bild als verdächtig einstuft, z. B. wegen „unregelmäßige Form“. Und natürlich muss die App gründlich getestet und laufend überwacht werden, um Fehlfunktionen zu erkennen. Der Weg zur vertrauenswürdigen KI führt nur über Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle.
Wie funktioniert in diesem Kontext Ihre „AI Trust Platform“?
Unsere Plattform ermöglicht den sicheren, verständlichen und effizienten Einkauf und Einsatz von KI für Organisationen. Sie verbindet KI-Governance-, Compliance- und technische Tests, um eine ganzheitliche und hochautomatisierte Lösung anzubieten, die die Leistung von KI-Systemen nachvollziehbar validiert – ohne dabei geistiges Eigentum oder private Daten offenlegen zu müssen!
Welche Vorteile haben Ihre Kunden davon?
Unsere Kunden profitieren in erster Linie davon, dass im Unternehmen eingesetzte KI-Systeme einheitlich überprüft werden, um einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten. Somit lassen sich finanzielle, rufschädigende und rechtliche Risiken vermeiden, die durch KI-Systeme verursacht werden könnten. Zusätzlich zur Sicherstellung der Leistung und Einhaltung von Standards im großen Maßstab ermöglicht unsere Testtechnologie auch, dass KI-Experten ihre knapp bemessenen Ressourcen für anspruchsvolle Aufgaben und Innovationen nutzen können, statt für zeitaufwendige Tests.
Wie setzen Sie die Fördergelder des Europäischen Innovationsrats (EIC) ein?
Mit dem Fördergeld erweitern wir unsere KI-Testtechnologie und bauen die erste automatisierte Risikomanagement-Plattform für generative KI-Systeme, welche die Umsetzung von Verordnungen wie dem EU AI Act erleichtern wird. Da die technologische Entwicklung auf diesem Gebiet besonders rasant voranschreitet, müssen auch wir unsere Testtechnologie stetig erweitern. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit unserer Lösung einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden Nutzung von KI leisten werden. Denn nur wenn KI sicher und verständlich ist, wird sie auf die breite Akzeptanz der Gesellschaft stoßen und unser Zusammenleben in Zukunft bereichern.
Herr Adamidis, welche Risiken entstehen bei der Vernachlässigung von Vertrauenswürdigkeit und Governance bei KI-Projekten?
Wie vorhin angesprochen, können enorme finanzielle, rufschädigende und rechtliche Risiken entstehen, wenn KI-Projekte Vertrauenswürdigkeit und Governance vernachlässigen. Viele Banken führen die KI-Revolution an, daher nehmen wir mal ein KI-gestütztes Kreditantragsverfahren als Beispiel. Versäumt man es, umfassende Tests und Governance-Praktiken in die Implementierung einzubeziehen, kann dies beispielsweise dazu führen, dass einzelnen Personen aufgrund von Merkmalen wie ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Wohnort schlechtere Bonitätsbewertungen zugewiesen werden, obwohl ihre finanzielle Lage stabil ist. Dies kann zu Klagen, Geldstrafen und Reputationsschäden führen – das Problem ist, dass die KI eine Blackbox ist und Unternehmen ohne ausführliche Tests und Übersichten möglicherweise gar nicht wissen, welche schlechten Praktiken sie anwenden.
Wo liegen die Herausforderungen die Black Boxes der KI transparent zu gestalten?
KI verknüpft Millionen von Parametern miteinander und macht es somit extrem schwierig, ihre Entscheidungsprozesse nachzuvollziehen. Angesichts der Komplexität sind Tests unglaublich zeitaufwendig und rechenintensiv. Da beide Ressourcen begrenzt und teuer sind, fällt es Unternehmen verständlicherweise schwer, das Thema Transparenz auf angemessene Weise anzugehen. Das Fehlen standardisierter Testmethoden trägt zudem dazu bei, dass es nahezu unmöglich ist, die wahren Fähigkeiten und Grenzen von KI-Lösungen zu beurteilen. Wenn es um den Kauf einer KI-Lösung geht, behaupten viele Anbieter, dass sie die relevanten Dimensionen getestet haben, aber mit welchen Daten und unter Berücksichtigung welcher Werte oder ethischen Grundsätze? Mit QuantPi arbeiten wir an der Lösung dieser Probleme. Wir beteiligen uns an der Entwicklung von Standards, wie z. B. der DIN SPEC 92001-3 über erklärbare KI, die agnostisch angewendet werden können und eine vergleichbare Basis für Transparenz schaffen und wir ermöglichen es Unternehmen, Tests selbst effizienter und übersichtlicher durchzuführen.

Philipp Adamidis betont: „Der Weg zur vertrauenswürdigen KI führt nur über Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle.“
Nach welchen Kriterien wird getestet?
Um eine verantwortungsvolle und vertrauenswürdige KI zu gewährleisten, legen wir den Schwerpunkt auf diverse Tests in den Dimensionen wie Bias, Robustheit, Erklärbarkeit und Datenqualität. Für regulierte Branchen oder Anwendungen bieten wir außerdem die Prüfung von KI-Systemen anhand relevanter Verordnungen und Standards an.
Wir nehmen diese Standards, wandeln sie in einen testbaren Katalog von Anforderungen (sowohl quantitativ als auch qualitativ) um und ermöglichen es Unternehmen, ihre Compliance- oder Qualitätssicherungsprozesse für KI-Systeme zu skalieren. Kunden können so die für sie relevanten Compliance-Anforderungen auswählen, z. B. den EU AI Act oder bestimmte ISO-Normen oder auch ihre eigenen Ethikrichtlinien mit unserer Plattform prüfen lassen.
Welche Möglichkeiten bieten Sie Ihren Partnern?
Unsere Partner, so wie unsere direkten Kunden, erhalten einen umfassenden und technisch validierten Einblick in die Risiken, Nutzen und den Compliance-Status von ihren KI-Systemen.
Da unsere Partner oft über fundierte Branchenkenntnisse verfügen, sind Sie in der Lage, mit uns Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Das ermöglicht Ihnen, Ihre Kunden bei wichtigen Entscheidungen zu unterstützen und ganzheitliche Angebote im Bereich der KI-Governance anzubieten. Manche Partner erstellen auch eigene KI-Assessments und skalieren den Inhalt dieser durch unsere technischen KI-Tests. Hinzu kommen Zertifizierungs- und Auditpartner, die z.B. unsere Platform nutzen, um einheitliche Nachweise zu Prüfungen konkreter KI-Systeme zu erhalten. Während Anwendungsfälle unserer Technologie und die Darstellungsformen der Testergebnisse von Partner zu Partner unterschiedlich sind, sorgen diese grundsätzlich für die Beschleunigung einer verantwortungsvollen KI-Transformation von Unternehmen.
Herr Adamidis, was haben Sie sich mit QuantPi zum Ziel gesetzt?
Unsere Vision ist es, der Gesellschaft eine sichere und selbstbestimmte Zukunft mit intelligenten Maschinen zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, haben wir uns das 3-Jahres-Ziel gesetzt, führende Unternehmen bei der Entwicklung vertrauenswürdiger und konformer KI zu unterstützen. Warum führende Unternehmen? Weil diese einen immensen Einfluss darauf haben, wie wir unser tägliches Leben gestalten. Wir müssen sicherstellen, dass die Prozesse, die uns umgeben, von Systemen angetrieben werden, die streng validiert und überwacht sind. Unsere Absicht ist es keineswegs, Innovation abzubremsen, sondern ihren Fortschritt auf verantwortungsvolle Weise zu unterstützen.
Bitte gehen Sie kurz auf Ihre Gründungsgeschichte ein.
Während unserer akademischen Laufbahn an der Universität des Saarlandes lernten Artur Suleymanov, Dr. Antoine Gautier und ich uns kennen. Das ist mittlerweile fast 8 Jahre her und von Anfang an waren wir als Technologie-Enthusiasten vom transformativen Potential der KI überzeugt und haben unsere Tage und Nächte mit diesem Thema verbracht.
Unsere Ambition war es, unsere eigene KI zu entwickeln und sie auf dem Markt zu etablieren. Nach den ersten gescheiterten Versuchen, Kunden von der Vertrauenswürdigkeit der KI-Black-Boxen zu überzeugen, hatten wir unseren Aha-Moment und erkannten die Notwendigkeit, dieses Vertrauensproblem auf technologischer Ebene anzugehen.
Als Teil des Ökosystems des weltweit führenden CISPA Helmholtz-Instituts für Cybersicherheit fanden wir die perfekte Umgebung für wegweisende Forschung im Bereich Sicherheit für KI. Schließlich gründeten wir 2020 QuantPi mit dem Ziel, Künstliche Intelligenz auch außerhalb der Forschung vertrauenswürdig zu machen.
CC BY-ND 4.0 DE
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#
Sie dürfen:
- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.
Unter den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.
- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.
Dekarbonisierung: Kern einer erfolgreichen Strategie für die grüne Transformation
/in Creative Commons CC BY-ND, Freie Inhalte, Nachhaltigkeit, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte/von Daniela HaselbauerDer Klimawandel ist unumkehrbar, die Klimaziele der EU sind ambitioniert. Gleichzeitig sprechen sich immer mehr Investoren und Konsumenten für mehr Nachhaltigkeit aus. Dies sind die entscheidenden Treiber für die grüne Transformation. Damit Unternehmen diesen Anforderungen zunehmend gerecht werden können, müssen sie ihren Prozessen so viel CO₂ wie möglich entziehen. Dekarbonisierung ist hier das Stichwort. Eine immense Herausforderung für die deutsche Wirtschaft. Die entscheidende Frage für eine erfolgreiche und profitable Zukunft lautet: Wie können Unternehmen das umsetzen und finanzieren?
Net-Zero1 werden, lautet das große Ziel. Aber wo genau sollen Unternehmer ansetzen? Der nachstehende Wegweiser für ein strukturiertes Vorgehen in vier Schritten hilft Unternehmen, die auf sie zurollende Welle der Dekarbonisierung in den Griff zu bekommen.
Schritt 1: Dekarbonisierung zur Chefsache erklären
Nachhaltigkeit ist ein strategisches Top-Thema und damit Chefsache. Denn jetzt werden die Weichen für die grüne Transformation gestellt, die das Geschäftsmodell auf lange Sicht prägen. Um volle Wirkung zu entfalten, muss die CO₂-Reduktion in allen Bereichen und auf allen Ebenen eines Unternehmens gemeinsam angegangen werden. Außerdem kann nur an der Unternehmensspitze entschieden werden, ob und gegebenenfalls welche strategischen Zukäufe für grüne Produktionskapazitäten nötig sind.
Schritt 2: Eine auf Transformationsfinanzierung spezialisierte Bank einschalten
Je früher Unternehmen und Bank gemeinsam Kennzahlen und Ziele für die grüne Transformation festlegen, desto eher besteht Klarheit über den Investitionsbedarf. Dabei sind die Erwartungen des Banken- und Kapitalmarktes mitzuberücksichtigen. Erst wenn Dekarbonisierungs- und Finanzierungsstrategie Hand in Hand gehen, wird Net-Zero zum Erfolgsmodell. Wie in anderen CO₂-intensiven Sektoren ist der Investitionsbedarf zum Beispiel in der Papier- und Verpackungsindustrie enorm. Das liegt an dem hohen Energieverbrauch und der Notwendigkeit, die Produktionsverfahren anzupassen, um CO₂-frei produzieren zu können. Eine solche Transformation kann ein Unternehmen schnell an die Grenzen seiner Verschuldungsfähigkeit bringen. Nur eine Bank, die alle Kapitalmarkt- und Förderinstrumente in die Finanzierungsstrategie integriert, kann einem Unternehmen entscheidende Vorteile sichern. Neben EU-Taxonomie-konformen, grünen und ESG-linked-Finanzierungsinstrumenten bieten sich Bundes- und KfW-Förderung an. Eine gefestigte und vertrauensvolle Beziehung zwischen Bank und Kunde ist an der Stelle insbesondere für Mittelständler entscheidend. Nicht alle sind am Kapitalmarkt aktiv. Deshalb sind hier bilaterale Kredite besonders gefragt.
Schritt 3: Transparenz über den CO₂-Status-Quo schaffen
Ausgangspunkt einer jeden Dekarbonisierungsstrategie ist der CO₂-Fußabdruck des Unternehmens. Das Standardformat, um zunächst den Status Quo abzubilden, ist die CO₂-Bilanz nach Greenhouse Gas Protocol. Sie gibt Aufschluss über die direkten und indirekten Emissionen eines Unternehmens. Damit können für alle Produktionsstandorte und Unternehmensbereiche die einzelnen Teilemissionsmengen berechnet sowie Verantwortlichkeiten von Führungskräften dafür festgelegt werden. Das ist Voraussetzung für Schritt vier.
Schritt 4: Konkrete Maßnahmen anstoßen und dann Stakeholder informieren
Dekarbonisierungs- und Finanzierungsstrategien stehen. Der CO₂-Ausstoß ist bekannt. Jetzt kann die Umsetzung beginnen. Zunächst stehen Energieeffizienzmaßnahmen im Fokus. Ebenso wichtig ist es, die Energieversorgung auf Grün umzustellen und Energie aus nachhaltigen Quellen selbst zu produzieren. Der aufwendigste Teil ist die Anpassung der Produktionsanlagen auf grüne Primärenergie. Nicht zu vermeidende Emissionen können durch ein sogenanntes Offsetting² ausgeglichen werden. Auch sollten Dekarbonisierungsmaßnahmen in der Lieferkette eingefordert werden. Um die Transformation insbesondere in den industriellen Sektoren zu unterstützen, sind sogenannte Carbon Contracts for Difference³ (CCfD) geplant. Die Bundesregierung arbeitet an entsprechenden Gesetzesvorhaben. Gerade in der Anlaufphase sollen sie das Unternehmensrisiko von Investitionen in treibhausgasarme Produktionsverfahren mindern. Last but not least sind die Stakeholder zu informieren. Nachhaltigkeit ist Überzeugungsarbeit. Regelmäßige Berichtsformate sind deshalb unerlässlich, um die Glaubwürdigkeit der eigenen Dekarbonisierungsstrategie herauszustellen.
Infografik: Dekarbonisierungspfad und -hebel in der Praxi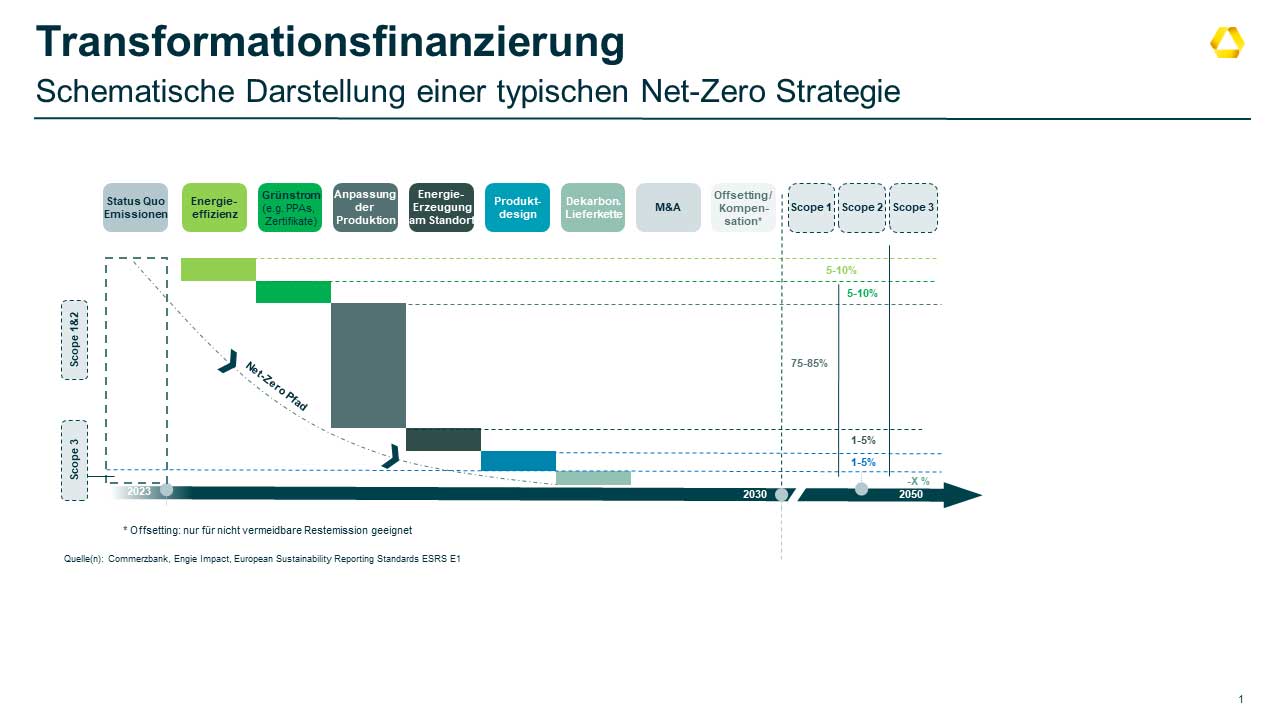
Fazit
Dekarbonisierungsstrategien entwickeln sich immer weiter. Zur Wahrheit gehört, dass insbesondere energieintensive Branchen bei der Umsetzung an technische Grenzen stoßen werden. Entscheidend ist aber, schon heute anzufangen und das eigene Unternehmen nach Möglichkeiten zu durchforsten, um CO₂ einzusparen. Das Machbare sollte umgesetzt und in der Kapitalstruktur berücksichtigt werden. Das honorieren Investoren, Banken, Geschäftspartner und Kunden. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Es ist Zeit, etwas zu bewegen!
„Jetzt werden die Weichen für die grüne Transformation gestellt, die das Geschäftsmodell auf lange Sicht prägen. Net-Zero werden, lautet das große Ziel. Aber wo genau sollen Unternehmer ansetzen? ”


Die Autoren:
Christine Rademacher, Bereichsleiterin Financial Engineering und Mitglied im Board Lending sowie Wolfgang Vitzthum, Director ,ESG & Sustainable Finance Solutions’ bei der Commerzbank, betonen: „Unser Wegweiser für ein strukturiertes Vorgehen in vier Schritten hilft Unternehmen, die auf sie zurollende Welle der Dekarbonisierung in den Griff zu bekommen.“
www.commerzbank.com/firmenkunden
——————————————————————————————————-
1Netto-Null (Net-Zero) ist strenger als Klimaneutralität. Die Reduktion von CO₂ kommt bei Net-Zero immer an erster Stelle. Ein CO₂-Ausgleich über zertifizierte Klimaprojekte ist nur in Ausnahmefällen möglich.
²Offsetting bedeutet, CO₂-Emissionen durch zertifizierte Klimaprojekte auszugleichen.
³ CCfD sind Klimaschutzverträge zwischen Staat und Unternehmen der energieintensiven Industrie. Mit ihnen sollen die Mehrkosten klimafreundlicher Produktionsverfahren gegenüber herkömmlichen Verfahren ausgeglichen werden. Das erste vorbereitende Verfahren des Förderprogramms wurde von der Bundesregierung am 06. Juni 2023 gestartet.
——————————————————————————————————-
CC BY-ND 4.0 DE
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#
Sie dürfen:
- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.
Unter den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.
- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.
Aufmacherbild/Quelle/ Lizenz
Bild von Acton Crawford auf Unsplash
Der beste Zeitpunkt mit KI zu starten ist jetzt!
/in Creative Commons CC BY-ND, Data Science, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte/von Daniela Haselbauer2024 ist das Jahr der Umsetzung von KI. Aber wie nutze ich KI optimal für mein Business? Der Experte und Vordenker Maximilian Vogel erklärt im Interview, welche Chancen KI und ML heute bieten. Und gibt Tipps, wie Unternehmen das Potenzial richtig nutzen, um massive Effizienzgewinne zu erzielen.
Herr Vogel, wie kann ich das Potenzial von KI und ML nutzen, im Hinblick auf Effizienzsteigerung und Automatisierung?
KI kann Prozesse in Sales, Logistik, Finanzen oder Marketing weit über 50 % automatisieren, also Effizienzsteigerungen von deutlich über 100 % erreichen. Eine multidimensionale KI besteht aus einzelnen AI-Workern, die komplexe Aufgaben lösen können – also z. B. einen Versicherungsfall von der Einreichung bis zur Regulierung zu bearbeiten. Ein AI-Worker kann einen Task über viele Einzeltätigkeiten und viele Tage hinweg verfolgen: Mails lesen, Schadensbilder bewerten, Informationen aus Datenbanken besorgen und Rückfragen an involvierte Parteien stellen.
Wie setze ich das in die Praxis um? 2023 war das Jahr des Redens über KI. International ist 2024 das Jahr der Umsetzung. In Deutschland verlieren wir uns oft noch in Grundsatzfragestellungen und die alten Kann-ich-, Darf-ich-Diskussionen, anstatt KI zu entwickeln, empirisch zu verproben und aus Ergebnissen zu lernen. Ich empfehle, einen Bereich mit großem Automatisierungspotential zu identifizieren und direkt – alleine oder mit einem Partner – in ein kleines Umsetzungsprojekt zu starten, das bei Erfolg ausgebaut werden kann.

Maximilian Vogel: „Ich empfehle, einen Bereich mit großem Automatisierungspotential zu identifizieren und direkt – alleine oder mit einem Partner – in ein kleines Umsetzungsprojekt zu starten.“
Wie sollten Unternehmen und Manager hier vorgehen?
Ganz einfach:
1. Think Business: Das heißt, eine KI-getriebene Plattform von der Aufgabe, vom Prozess, von Effizienzeffekten heraus zu denken – und nicht von der Technologie her.
2. Start small: Also mit einem Proof of Concept starten, der zu einer Beta ausgebaut werden kann und dann zu einem produktiven System.
3. Vendor lock-in vermeiden: Egal wie gut ein Anbieter ist – die KI-Lösung des Unternehmens sollte so gebaut werden, dass sie diesem gehört. Sie sollte nicht so tief in die Modelle oder Hosting-Lösung des Anbieters integriert sein, dass ein späterer Wechsel sehr schwierig oder unmöglich ist.
Welche KI/ML-Projekte lagen und liegen Ihnen am Herzen?
Ein Herzensprojekt für mich war die Unterstützung von BMW bei der Entwicklung des CarExperts, einer KI-getriebenen Assistentenlösung im Auto, die in der Lage ist, auf Basis von sogenannter Retrieval Augmented Generation die Fragen des Fahrers zu beantworten und mit ihm natürlichsprachliche Konversation zu betreiben.
Ein weiteres Projekt, das wir gemeinsam mit einigen großartigen Partnern realisiert haben: Ein AI-Worker verwaltet Marken, bewertet Konflikte und verteidigt die Marken gegen konkurrierende Markeneinträge. Der AI-Worker führt hier keine Handlangertätigkeit aus, sondern macht eine Arbeit, für die intensive markenrechtliche Vorbildung erforderlich ist. Und tatsächlich hat sich gezeigt: Auch das funktioniert mit KI!
Herr Vogel, welches Mindset sollte ich für das erste Projekt mitbringen und was sollte ich vermeiden?
Alle reden über KI, aber falsche Vorstellungen und Ängste verhindern noch den systematischen Einsatz in vielen Unternehmen. Nahezu jeder hat inzwischen die unglaublichen Fähigkeiten generativer KI-Systeme ausprobiert. In den meisten Unternehmen nutzen Mitarbeiter Plattformen wie ChatGPT – erlaubt oder heimlich – auch für berufliche Tätigkeiten. Dennoch verhindern oft alte Denkmuster einen produktiven Umgang mit neuen Technologien: Wir wissen immer ganz genau, was man nicht darf, was man nicht soll, was problematisch ist und verwenden das als Ausrede dafür, erst einmal nichts zu tun: Datenschutz, sogenannte Halluzinationen oder Bias der Modelle, Qualität und Struktur der unternehmenseigenen Daten. In Wirklichkeit sind diese Fragestellungen für die meisten Business-Anwendungen lösbar bzw. bereits gelöst. Das Wichtigste für ein produktives KI-Projekt ist nicht tiefes Fachwissen im Bereich machine learning – das kann man sich dazu holen – sondern eine Vision, was man erreichen will. Offenheit. Die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren; zu lernen; und schnell umzusteuern, wenn sich neue technologische Möglichkeiten bieten oder etwas nicht funktioniert.
OK, und wie starte ich jetzt?
Starten Sie klein, aber so schnell wie möglich – in einem großen Feld, in dem sie später skalieren können, aber mit einer überschaubaren ersten Fragestellung. Gehen Sie bei Erfolg in eine Beta und skalieren sie das Vorhaben dann. Verzetteln Sie sich nicht in umfangreiche Strategieausarbeitung in Bezug auf Technologien, Anwendungsbereiche, Vendoren – die KI-Landschaft ändert sich schneller, als Sie Ihre Folien gerade ziehen können. Verfolgen Sie dennoch ambitionierte Visionen – aber aus einer Business-Sicht. Etwa „Ich möchte im Salesbereich 90 % der kleineren Angebotsanfragen komplett automatisiert bearbeiten lassen, meine Teams sollen nur noch die großen, komplexen und werthaltigen Anfragen manuell bearbeiten.“ Suchen Sie sich Umsetzungspartner – intern oder extern – die ihre Vision teilen.Verbinden Sie – aber nicht gleich am Anfang – die KI-Plattform über Schnittstellen mit Ihren existierenden Systemen. KI kann nicht jeden Edge Case gut bearbeiten – schaffen Sie eine Schnittstelle zu menschlichen Teams für schwer lösbare Fragestellungen.
Inwieweit können Sie Unternehmen bei der Entwicklung neuer ML & KI Strategien und Lösungen unterstützen?
Wir unterstützen seit fünf Jahren Großunternehmen und große Mittelständler bei der Entwicklung KI-getriebener Lösungen. Das sind einerseits Conversational AI Systeme, die auf Basis von generativer KI mit Nutzern kommunizieren können. Auf der anderen Seite sind es Automatisierungslösungen auf Basis multidimensionaler KI, also AI-Worker, die einen großen Task teilweise über Tage und viele Interaktionsschritte fallabschließend bearbeiten können.
Wir unterstützen unsere Kunden und Partner hauptsächlich in der Konzeption der Lösung, der Modell- und Framework-Auswahl, der Entwicklung, dem Prompt Engineering, der Anbindung an Schnittstellen und in MLOps und technischem Betrieb der Lösung. Für Fragestellungen der Hardwareintegration haben wir Partner.
Gibt es aktuelle Beispiele?
Neben den beiden oben genannten vielleicht noch zwei: Wir entwickeln für das Startup Adele eine KI-getriebene Lösung, die ältere und pflegebedürftige Patienten betreut. Und wir bauen aktuell für ein großes Road-Logistikunternehmen eine multidimensionale Worker-AI, die auf Kundenanfragen eigenständig Angebote erstellt.
Was bedeutet KI/ML und nachhaltige Entwicklung für Sie?
Welche Bedeutung haben die neuen Technologien Rund um KI/ML im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen und Gesellschaft?
Für eine Green AI müssen wir einerseits den riesigen Fußabdruck der Modelle in Training und Inferenz verringern. Kleinere, effizientere Modelle sind hier eine Lösung. Auf der anderen Seite kann uns KI massiv dabei unterstützen, Ressourcen effizienter zu nutzen: Licht oder Heizung nur anzuschalten, wenn sie gebraucht wird, Sekundärrohstoffe zu trennen, etc.
Inwieweit werden die neuen Technologien unsere Wirtschaft und unseren Standort verändern?
Die generative KI und hier vor allem die multidimensionalen Worker werden weltweit zu massiven Effizienzgewinnen auch im Bereich der intellektuell anspruchsvollen Tätigkeiten führen. Die Mehrzahl der Firmen in Deutschland ist im Moment noch zögerlich – aber es gibt auch hier eine Reihe von Unternehmen, die das Thema ernsthaft, visionär und aggressiv angehen. Leider kann die EU im Bereich der Basistechnologien für AI wie AI-Modelle oder KI-Chips kaum mit den USA oder Ostasien konkurrieren. Und leider verlieren wir weiter den Anschluss: Unsere Kapitalmärkte gerade für Technologieunternehmen sind unterentwickelt und wir machen IT-Unternehmen durch immer neue Regelungen – oft sicherlich gut gemeint – das Leben schwer. Ein aktuelles Beispiel ist der EU AI Act, der es in einigen Anwendungsbereichen deutlich komplizierter macht, KI in Europa auf den Markt zu bringen. Wir müssen uns entscheiden, ob wir vorne mitspielen wollen oder ob wir Hochtechnologie einfach weitgehend aus Übersee beziehen wollen. Wenn wir wieder mitspielen wollen, müssen wir schnell und grundlegend umsteuern, ein bisschen Forschungsförderung hier und da wird das Bild nicht ändern.
CC BY-ND 4.0 DE
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#
Sie dürfen:
- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.
Unter den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.
- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.
Eine Megawattbatterie aus Salz für die Energiewende
/in Creative Commons CC BY-ND, Freie Inhalte, Nachhaltigkeit, Neue Gesellschaft, Smart Citys, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte, Wissenskultur/von Daniela HaselbauerIm Interview erklärt Uwe Ahrens, Vorstand der börsennotierten Altech Advanced Materials AG, die Vorzüge der innovativen Großbatterie für Industrie und Energiewirtschaft.
Herr Ahrens, was ist das Revolutionäre an Ihrer neuen Batterietechnologie?
Wir bringen gerade mit unserem Joint- Venture-Partner, dem Fraunhofer-Institut IKTS, eine Festkörperbatterie für den stationären Betrieb namens CERENERGY in die Kommerzialisierung. Diese neuartige Batterie ist frei von kritischen Rohstoffen wie Kobalt, Grafit und Lithium und benötigt auch kein Kupfer. Unsere Batterie ist aufgrund der Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit perfekt für den stationären Einsatz in Stromnetzen, bei erneuerbaren Energien und in der Industrie geeignet und besteht lediglich aus Kochsalz, Keramik und Nickel. Sie ist nicht brennbar und behält ihre volle Leistung über den gesamten Lebenszyklus von über 15 Jahren. Somit ist die Lebensdauer weitaus höher als die von aktuell eingesetzten Batteriespeichern. CERENERGY ist extrem robust und kann ohne externe Systeme zur Kühlung oder Heizung unter jeglichen klimatischen Bedingungen betrieben werden und benötigt zudem keine Anlagen zum Feuerschutz, da sie nicht brennbar ist. Sie löst alle Herausforderungen für einen Zwischenspeicher für regenerative Energiequellen, die wir aktuell so dringend brauchen.

Uwe Ahrens: „Unsere Batterie ist aufgrund der Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit perfekt für den stationären Einsatz in Stromnetzen, bei erneuerbaren Energien und in der Industrie geeignet“.
Welche Vorteile bringt der Einsatz als Netzbatteriespeicher?
Unsere CERENERGY-Batterie ist eine Plug-and-Play-Lösung. Sie kann sogar im geladenen Zustand an ihren Bestimmungsort transportiert werden. Da keine externen Systeme benötigt werden, kann sie in kürzester Zeit in Betrieb gehen und ist im Unterhalt sehr günstig und effizient. Und da keine Brandgefahr von der Batterie ausgeht, kann sie auch neben Tankanlagen stehen und so einen Beitrag in der E-Mobility leisten. Die Megawattsysteme in Containerbauweise können sogar übereinandergestapelt werden und sind absolut witterungsbeständig. Zudem ist herauszustellen, dass Nutzer von CERENERGY einen höheren Ertrag erwirtschaften können. Die Batterie verliert über die gesamte Lebensdauer nicht an Leistung. Mehrere Ladezyklen innerhalb von 24 Stunden sind zudem möglich, ohne dass die Batterie Schaden nimmt.
Welche Technologie steckt dahinter und wie lange hat die Entwicklung gedauert?
Die aktuelle Entwicklung unserer Festkörperbatterie basiert auf dem technologischen Prinzip der sogenannten „Zebra“-Batterie, die bereits in den 70er Jahren entwickelt wurde, aber es nie zur breiten Anwendung geschafft hat. Das IKTS hat diese Technologie aufgegriffen und über acht Jahre zur optimierten industriellen Anwendung weiterentwickelt. Wichtige technologische Details wurden gelöst und ein stabiler Produktionsprozess zur Massenherstellung entwickelt, der nun die Kommerzialisierung ermöglicht. Die eigentlichen Batteriezellen bestehen aus einem festen Keramikrohr, dem Festkörperelektrolyt, durch den Natrium-Ionen geleitet werden können. Zwischen der Außenfläche des Keramikrohres und der Metallhülle bildet sich die Anode jedes Mal neu und baut sich beim Entladen wieder verlustfrei ab.
Was sind die nächsten Schritte zur Markteinführung?
Prototypen der CERENERGY-Batteriezellen laufen seit Jahren stabil. Das Design und Engineering der industriellen Produktionsanlagen sind abgeschlossen. Das Grundstück für das Werk in Schwarze Pumpe in Sachsen ist erworben, die Bauanträge sind gestellt und die Anlagen durchkonzipiert sowie alle Unterlieferanten ausgewählt. Die endgültige Machbarkeitsstudie wollen wir zeitnah abschließen und dann noch im laufenden Jahr die Finanzierung umsetzen. Hierfür haben wir eine Reihe von Förderanträgen auf Landes-, Bundes und auch EU-Ebene gestellt und gehen von einem positiven Bescheid noch in diesem Jahr aus. Mit einer strukturierten Finanzierung, bestehend aus Eigenkapital, Fremdkapital und Fördermitteln, gehen wir von einer schnellen Umsetzung des Projektes aus.
Wie viel Batteriemodule sind in einer ersten Produktionslinie geplant?
In der ersten Ausbaustufe unseres geplanten Werkes für CERENERGY mit einer ersten Produktionsstraße gehen wir von einer jährlichen Produktionsleistung von 120 MWh aus. Diese Leistung wollen wir dann sukzessive erhöhen. Unser Werk wird so ausgelegt sein, dass wir zügig weitere Produktionsstraßen errichten können. Wir denken auch jetzt schon weiter und haben uns in direkter Nachbarschaft eine Kaufoption für ein weiteres Gelände gesichert. Dann reden wir über Kapazitäten im Gigawattbereich.
Herr Ahrens, welche Bedeutung haben Netzbatteriespeicher im Kontext unserer nachhaltigen Entwicklung?
Netzspeicherbatterien sind das Missing Link der Energiewende. Im Prinzip ist die Erzeugung von Strom aus regenerativen Energiequellen wie Wind und Sonne gelöst. Nur scheint nicht immer in Deutschland die Sonne und der Wind weht auch nicht gleichmäßig. Dazu kommt, dass der erneuerbare Strom nicht an dem Ort und zu der Zeit ist, an dem er gebraucht wird. Der Strom kann nicht geleitet werden, weil die Stromnetze schon voll sind. Dies ist hinreichend bekannt. Fakt ist, dass die Bundesnetzagentur die Kosten des ungenutzten Stroms – Redispatch genannt – im Jahr 2022 auf über 4 Mrd. EUR beziffert. Was wir demnach benötigen, sind Speicher, um Spitzen auszugleichen, die Netze zu stabilisieren und den Strom dann zu liefern, wenn der Bedarf am höchsten ist. Nur mit großen stationären Batterie-Speichern lässt sich diese Energie nutzen und die Energiewende realisieren. Andernfalls führt der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien nur zu noch mehr ungenutzten Energieüberschuss und damit zu höheren Kosten. Der Bedarf an Netzspeichern ist da und ökonomisch als auch volkswirtschaftlich sinnvoll.
Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Markt für Energiespeicher in den nächsten Jahren entwickeln?
Der Netzbatterie-Markt wächst weltweit enorm. Laut einer aktuellen Studie von Bloomberg NEF hat die Energiespeicherung ein weltweites Potential von 620 Mrd. US-Dollar bis 2040. Das Problem ist also weniger die Nachfrage, sondern vielmehr das Angebot an adäquaten Speicherlösungen. Kritische Stoffe wie Lithium, Kobalt und Graphit schwanken schon jetzt enorm im Preis. Abgesehen davon, dass die Abhängigkeiten zu Drittstaaten sehr hoch ist. Das zeigt allein schon das Beispiel Graphit. Zu rund 90 % wird der Weltmarkt für diesen wichtigen Batteriestoff aus Asien bedient. Da entstehen Abhängigkeiten, die auch aus geopolitischer vermieden werden sollten. Es ist absehbar, dass die entscheidenden Rohstoffe nicht ausreichen werden, um den Bedarf zu decken. Wir brauchen also Alternativen in Europa, die ohne diese kritischen Stoffe auskommen.
Welchen Zielmarkt sprechen Sie mit Ihren neuen Festkörperbatterien an?
Wir konzentrieren uns im ersten Schritt auf Betreiber von Energienetzen und großen Solar- und Windparks. Diese haben den dringenden Bedarf, die Energiemengen aus der erneuerbaren Energiegewinnung aus Wind und Solar zu puffern und zeitversetzt in die Netze einzuspeisen. Darüber hinaus gibt es auch eine sehr große Nachfrage durch die Stromabnehmer vor Ort mittels der Speicher teure Energiespitzen zu kappen. Dieses sogenannte Peakshaving kann die Stromkosten von Betrieben deutlich senken.
Stichwort E-Mobilität – auch hier gibt es konkrete Anwendungsfelder: Wenn jetzt begonnen wird, LKW-Flotten zu elektrifizieren, müssen diese auch schnellgeladen werden, ohne dass die Netze bei den Speditionen und den Autohöfen in die „Knie gehen“, da diese nicht in der Lage sind, eine so große Menge Strom in kurzer Zeit zu leiten. Unsere CERENGY-Batterie ist für diesen Anwendungsfall prädestiniert. Da sie nicht brennbar ist, kann Sie ohne sonst erforderliche Sicherheitsabstände in die bestehende Tankinfrastruktur integriert werden und für die entsprechende Ladeinfrastruktur für den Schwerlastverkehr genutzt werden. Weitere Anwendungsfelder können kommunale Niederspannungsnetze sein oder energieintensive Industrien, die von Gas auf Strom umstellen. Auch der Einsatz als Notstromaggregate in Krankenhäusern oder anderen öffentlichen Gebäuden ist aufgrund der absoluten Sicherheit möglich.
Mit welcher Lebensdauer der Batterien kann gerechnet werden?
Die Lebensdauer einer Batterie wird üblicherweise in Ladezyklen angegeben. Mit CERENERGY können deutlich über 7.500 Ladezyklen realisiert werden. Umgerechnet sind das mehr als 15 Jahre – gegebenenfalls auch deutlich mehr, da während des Ladeprozesses über die Jahre hinweg keine Komponenten der Batteriezelle verbraucht oder verschmutzt werden. Die CERENERGY-Batterie altert nicht. Die von uns angestrebte Lebensdauer entspricht in etwa dem Doppelten, was heute bei den gebräuchlichen Lithium-Ionen-Batterien möglich ist und das bei 100 % Leistung über die gesamte Lebensdauer.
Mit welchen Kosten müssen Industriekunden rechnen?
CERENERGY ist unter Vollkostenbetrachtung die effizienteste und günstigste Festkörperbatterie am Markt. Während des gesamten Lebenszyklus einer Batterie muss man ja nicht nur den Kaufpreis beachten. Hinzu kommen Wartungs- und Instandhaltungskosten und Kosten für die Entsorgung. Auch die Anzahl der Ladezyklen, die innerhalb der Garantieleistung möglich sind, ist eine wichtige Kennzahl.
Eine marktübliche Lösung heute braucht eine Kühlung bzw. Heizung, einen Wasseranschluss und regelmäßige Pflege mit Wechsel von Verschließteilen. All diese Wartungskosten der Nebenaggregate gibt es bei unserem System nicht, weil diese schlicht und ergreifend nicht benötigt werden. Die CERENGERY-Batterie kann innerhalb von 24 Stunden mehrfach geladen und entladen werden, ohne dass die Batterie Schaden nimmt. Andere Systeme sind häufig auf einen Zyklus begrenzt. Da die Batterie aufgrund der unkritischen Rohstoffe sowie der Nicht-Brennbarkeit einfach vollständig recyclebar ist, fallen keine Entsorgungskosten an. Hier ist herauszustellen, dass der Nickelanteil geschätzt zu 98 % zurückgewonnen und wieder verwertet werden kann.
Weltweit sorgen sich viele Unternehmen um die Knappheit von Rohstoffen. Wie sehr betrifft das Ihr Unternehmen?
Unsere Rohstoffe werden wir komplett aus Europa beziehen. Dazu haben wir bereits entsprechende Lieferanten ausgewählt und Absichtserklärungen abgeschlossen. Es gibt somit keine Abhängigkeiten zu Drittstaaten oder komplexe Lieferketten, die unterbrochen werden können. Das war uns sehr wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass eine europäische Batterieproduktion so autark wie möglich sein sollte. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten.
www.altechadvancedmaterials.com
CC BY-ND 4.0 DE
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#
Sie dürfen:
- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.
Unter den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.
- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.
Infrastruktur finanzieren: Wir treiben die Energiewende voran.
/in Creative Commons CC BY-ND, Nachhaltigkeit, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte/von Daniela HaselbauerSimon Bartmann, Co-CEO von Bullfinch, erklärt im Gespräch mit der TREND-REPORT-Redaktion, wie Installateure ihre Produktpalette in kürzester Zeit erweitern können.
Herr Bartmann, was haben Sie sich mit Ihrem Team und Bullfinch zum Ziel gesetzt?
Bis 2030 planen wir ein Finanzierungsvolumen von bis zu vier Mrd. Euro und ergänzen unser Produktportfolio rund um Energiegemeinschaften, Energie-Services wie Smart-Meter-Infrastruktur inklusive dynamischer Tarife. Außerdem sollen bis zu 5.000 Installationsbetriebe und Vertriebspartner auf die Energy-as-a-Service Platform gebracht werden. Parallel planen wir die Internationalisierung mit unseren OEM-Partnern. Schon heute können wir auf über 200 Millionen Euro kontrahiertes Finanzierungsvolumen blicken und mehrere tausend Kunden mit Solarenergie nachhaltig und sicher versorgen.

Simon Bartmann betont: „ Wir können unseren Endkunden während des Vor-Ort-Termins eine Finanzierungslösung in Echtzeit anbieten.“
Wie digital ist der ganze Prozess gestaltet worden?
Stadtwerke, Energie-Dienstleister, Energy-Start-Ups, Projektentwickler oder Installateure können auf unsere Lösung per Web Applikation zugreifen und in ihren Vertriebsprozess integrieren und dem Endkunden während des Vor-Ort-Termins eine Finanzierungslösung in Echtzeit anbieten. Dabei können Produkte wie Solaranlagen, Wechselrichter, Smart Meter, Wallbox-Artikel oder Speicher finanziert werden. Des Weiteren können Vertriebspartner auf die dynamischen Tarife zurückgreifen.
Welche Vorteile haben Ihre Partner davon?
Unsere Vertriebspartner und Endkunden profitieren von einer schnellen Bestellstrecke ohne Bürokratie und Medienbrüchen. Heißt kein zeitintensiver Gang zur Bank oder endlose Kämpfe mit Papiertigern. Dazu bieten wir mit der Bullfinch Service Card technischen Service gemeinsam mit unseren Partnern an. Durch unsere dynamischen Tarife kann der Endkunde seine monatliche Rate optimieren. Des Weiteren investieren wir in den Vertriebspartner in der Region, damit dieser mehr Kunden durch unseren Support bekommt. Eine Partnerschaft, die sich für alle lohnt.
Energiegemeinschaften sind en Vogue: Welche Strategie verfolgen Sie?
Absolut! Hier sehen wir die Zukunft des Marktes und wollen Milliarden in diese Infrastruktur investieren – vergleichbar mit Investitionen in Glasfaser, 5G oder regionale Kraftwerke. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir die Projektgesellschaft Solarausbau Deutschland gegründet. In den ersten Regionen wie Norddeutschland bauen wir bereits erfolgreich die Energie-Infrastruktur der Zukunft. Mit unseren Service Points in u. a. Varel rollen wir die Projekte lokal mit hoher Qualität aus.
CC BY-ND 4.0 DE
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#
Sie dürfen:
- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.
Unter den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.
- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.
„Hört auf, wahllos zu digitalisieren! Fangt an, zu transformieren!“
/in Creative Commons CC BY-ND, Digitalisierung, Freie Inhalte, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte/von Daniela HaselbauerDie TREND-REPORT-Redaktion im Gespräch mit Sebastian Wohlrapp, Managing Director von diconium, über den entscheidenden Unterschied zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation.
Herr Wohlrapp, mit diconium begleiten Sie Unternehmen bei der digitalen Transformation. Mit welcher Herausforderung treten die Organisationen an Sie heran?
Unternehmen digitalisieren ihre Prozesse bereits seit vielen Jahren. Digitalisierung passiert jeden Tag, überall. Die unerfüllte Erwartung, dass Mitmachen Wunder wirkt, hat die meisten digitalisierungsmüde gemacht. Analoge Prozesse zu digitalisieren, einen digitalen Kanal zu etablieren oder eine App zu launchen, hat erstmal noch nichts mit digitaler Transformation zu tun. Das generiert eventuell lokal Mehrwert, aber in den wenigsten Fällen eine bessere oder neue Wertschöpfung. Und genau hier liegt die Chance: Wenn der Marktzugang, die Angebote und die dauerhafte Leistungserstellung synchronisiert auf das Nutzen von digitalen Technologien ausgerichtet sind, beginnt die in der Bilanz sichtbare Wertschöpfung aus Software, Daten und KI. Digitalisierung ist ein Teil davon, aber nicht hinreichend! Und genau da setzen wir an: Als Partner für digitales Wachstum entlang der gesamten Wertschöpfungskette begleiten wir Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation.

Sebastian Wohlrapp betont: „Wagt Neues und denkt groß! Transformation kann sehr viel Gutes hervorbringen.“
Was sind die wichtigsten Rahmenbedingungen, die den Erfolg der digitalen Transformation eines Unternehmens bestimmen?
Die meisten Organisationen scheitern bei der digitalen Transformation bereits an grundlegenden Dingen. Es ist entscheidend, gleich zu Beginn eine Vision und erste klare Ziele zu definieren, wo die Reise hingehen soll. Der nächste Schritt ist eine gute und realistische strategische Planung. Die darin abgebildete Wirkung auf die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen erzeugt das Buy-In in der Führungsebene – eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg einer Transformation. Dabei geht es nicht nur um die Bereitstellung von notwendigen Ressourcen, sondern auch darum, auf allen Ebenen des Unternehmens eine Bereitschaft für Veränderung zu generieren. Während in stabilen, eher linearen Wertschöpfungsmodellen vor allem eine gute Aufbauorganisation langfristig den Erfolg sichert, erfordert Wertschöpfung aus Software, Daten und KI in erster Linie eine anpassungsfähige Ablauforganisation. Zu guter Letzt braucht es geeignete Technologien und einen agilen Ansatz, um auf sich ändernde Gegebenheiten reagieren zu können.
Welche Handlungsempfehlung würden Sie Unternehmen mit auf den Weg geben, um erfolgreich in die digitale Transformation zu starten?
Hört auf, wahllos zu digitalisieren! Blinder Aktionismus ist aus meiner Sicht die falsche Herangehensweise. Wer glaubt, sein Unternehmen mit dem Kauf einer digitalen Lösung oder der Digitalisierung einer einzelnen Abteilung transformieren zu können, liegt komplett falsch.
Analysiert Eure Ausgangslage! Unternehmen müssen sich und ihre Fähigkeiten vor dem Start in die Transformationsphase hinterfragen. Welche Rolle soll das Unternehmen in Zukunft in welchen Ökosystemen spielen? So wird aufgedeckt, was schon da ist und was noch fehlt. Das schafft die Grundlage für alles, was danach kommt.
Wagt Neues und denkt groß! Eine Transformation kann sehr viel Gutes hervorbringen, aber sie ist kein Change, den man einfach managen oder sogar delegieren kann. Unternehmen scheitern meiner Erfahrung nach nicht, weil sie die falschen Dinge tun. Sie scheitern, weil sie zu lange Dinge tun, die früher richtig waren.
https://diconium.com/de/transformation
CC BY-ND 4.0 DE
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#
Sie dürfen:
- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.
Unter den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.
- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.
Innovationen für die „All Electric Society“
/in Creative Commons CC BY-ND, Digitalisierung, Freie Inhalte, Mobilität, Nachhaltigkeit, Smart Citys, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte, Wissenskultur/von Daniela HaselbauerProf. Dr.-Ing. Bodach im Gespräch mit der TREND-REPORT-Redaktion, über aktuelle Forschungsprojekte an der Westsächsischen Hochschule Zwickau.
Herr Prof. Bodach, inwieweit sind wir schon auf dem Weg zur „All Electric Society“?
Aus meiner Sicht rückt die Umsetzung der All Electric Society (AES), die bereits 2016 als ein mögliches Ziel in einer Delphi-Studie des BDEW genannt wurde, in absehbarer Zeit näher. Angetrieben wird dies u. a. durch Fortschritte in der Elektromobilität und dem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien im Strommix. Dies ist nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit sichtbar. Der globale Ausbau regenerativer Kraftwerke steigt stetig. Auf dem Weg dorthin sind jedoch noch Herausforderungen zu lösen, dazu zählen der flächendeckende Ausbau intelligenter Verteilnetze, die Weiterentwicklung effektiver Speichertechnologien und der damit verbundene Aufbau grundlastfähiger regenerativer Kraftwerke.
Welche Ziele hat in diesem Kontext Ihre Forschungsallianz?
Die Allianz ist eine offene Anlaufstelle für die All Electric Society. Egal ob Kommune, KMU, global Player, NGO, Energieversorger oder Forschungseinrichtung. Jeder ist eingeladen, mitzuwirken und seine Expertise einzubringen. Denn nur wenn alle an einem Strang ziehen, ist die Realisierung der AES und somit die Bewältigung des Klimawandels möglich. Die Mitglieder der Allianz haben sich hierzu alle auf eine Zusammenarbeit zur Umsetzung der gemeinsamen Vision der AES verständigt. Es sollen Forschungskooperationen geschaffen und ein Ideenaustausch initiiert werden. Weiterhin soll mit der Allianz auch ein Wissens- und Erkenntnistransfer in die Gesellschaft angestoßen werden.

Prof. Dr.-Ing. Bodach erklärt: „Die Allianz ist eine offene Anlaufstelle für die All Electric Society. Egal ob Kommune, KMU, global Player, NGO, Energieversorger oder Forschungseinrichtung: Jeder ist eingeladen!“ (Bildquelle: WHZ/Helge Gerischer)
Mit welchen Forschungsprojekten sind Sie gerade beschäftigt?
Unser derzeit größtes Forschungsprojekt an der Westsächsischen Hochschule Zwickau ist „JenErgieReal“. Gemeinsam mit den Stadtwerken Jena und weiteren Partnern entwickeln wir hier ein Reallabor zur Demonstration der Umsetzbarkeit der AES auf Quartiersebene. Es soll u. a. ein virtuelles Kraftwerk entstehen, welches konventionelle Versorgungsstrukturen optimieren und teilweise substituieren kann.
Wir zielen darauf ab, Energiebedarfe durch intelligente Steuerungen zu reduzieren und Netzausbaukosten mittels Energiespeichern zu minimieren. In einem weiteren Projekt erforscht bspw. unsere Nachwuchsforschergruppe „autonomous2grid“, wie Elektrofahrzeuge zukünftig, mit Einwilligung der Nutzer, autonom zu Ladestationen fahren und dort sogar netzdienlich sein können. Auf diese Weise sollen dann völlig neue, energieoptimierte Mobilitäts- und Quartierskonzepte möglich werden.
Wie kann die Transformation gemeistert werden?
Eine fundamentale Grundlage für eine solche Transformation ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Damit meine ich nicht, dass sich unterschiedliche Fachdisziplinen mal eben kurz unterhalten. Es braucht eine tiefgreifendere, verwobene Bearbeitungsstruktur. Nur, wenn alle betreffenden Akteure gemeinsam agieren, kann eine CO2-neutrale Energieversorgung erreicht werden. Sicher liegen die Schwerpunkte in meinem Fachgebiet zumeist beim elektrischen Netz bzw. der Energieversorgung. Ein wichtiger Punkt, den wir Techniker dabei aber gern vergessen, ist die Akzeptanz, vor allem bei den Bürgern. Nur die in der Gesellschaft akzeptierten Technologien und Methoden werden sich auch durchsetzen können.
Welche Bedeutung hat ein sektorenübergreifendes Energiesystem?
Das elektrische Energieversorgungssystem ist bereits jetzt sektorenübergreifend, da es die notwendige Hilfsenergie für die Nutzung aller Energieträger zur Verfügung stellt. Die Zeiten, in denen einzelne Sektoren losgelöst voneinander betrachtet werden konnten, sind vorbei. Nunmehr geht es darum, Energiebedarfe in einem Sektor auch durch Überschüsse oder sogenannte Flexibilitäten (eine momentan nicht genutzte Energiemenge) eines anderen Sektors decken zu können. In diesem Zusammenhang sind nicht die bilanziellen Energiemengen relevant, sondern die benötigte Leistung ist entscheidend. Die Steuerungssysteme müssen in Echtzeit reagieren und die Marktteilnehmer darauf vorbereitet sein.
Was macht das Forschen im Kontext der Disziplinen Mobilität, Elektrizität und Digitalisierung so spannend?
Die drei Bereiche ergänzen sich perfekt, jede der Disziplinen ist ein Teil der Lösung zu einer CO2-neutralen Zukunft. Die anwendungsorientierte Forschung, gerade in Reallaboren, ist sofort relevant. Unsere Erkenntnisse sind fast schon gestern für neue Technologien nötig. Weiterhin arbeitet man hier mit allen Akteuren, also auch mit den Nutzern der Technologien, eng zusammen. Das macht die Arbeit besonders spannend.
Herr Prof. Bodach, welche Rolle spielen KI und ML im Kontext der „All Electric Society“?
Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen sind elementare Bausteine der Digitalisierung und meiner Meinung nach Schlüssel zur Realisierung der All Electric Society. Es führt auch für uns Energietechniker kein Weg mehr an diesen Themen vorbei. Gerade wenn man an zukünftige Versorgungsaufgaben der Energieversorgung denkt, oder die Steuerbarkeit von elektrischen Verbrauchern wie Ladesäulen und Wärmepumpen, wird ersichtlich, dass die AES nur unter Zuhilfenahme dieser Bausteine funktionieren kann. Weiterhin müssen wir auch bedenken, dass durch die zunehmende Vernetzung unserer Welt auch viele Handlungen im elektrischen Netz komplexer werden. Auch hier können KI und ML dabei helfen, die Energieversorgung zu optimieren. Die Herausforderung ist es, bei stetig wachsender Komplexität, die Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit unserer elektrischen Energieversorgung auf dem heutigen, hohen Niveau zu halten. Es ist somit unumgänglich, diese Technologien bei der Umsetzung der AES zu nutzen.
Sind die Rahmenbedingungen unserer Regierung ausreichend, um die Transformation zu meistern?
Die Politik steht hier vor großen Herausforderungen, ich bin froh mit meinem Team „nur“ technische Lösungen erarbeiten zu müssen. Entscheidend ist es, Rahmenbedingungen zu setzen, die verlässlich sind. Mit der Investition in ein Betriebsmittel legt man sich für mehrere Jahrzehnte fest. Die Politik hat hier sehr viele Stellschrauben, die allerdings sehr behutsam und überlegt justiert werden müssen, sonst drohen unerwünschte Nebeneffekte. Hierbei ist es notwendig, den technischen Fortschritt im Auge zu behalten. Netzdienliche Energiespeicher, welche dem Netzbetreiber zuzuordnen sind, können bspw. derzeit nicht am Energiemarkt teilnehmen und sich damit nur schwer amortisieren. Hier muss u.a. nachgebessert werden. Es ist also wichtig, dass die Regierung eine geschlossene Strategie zur Energiewende verfolgt. Wir als Forschungseinrichtung wollen hierfür die richtigen Werkzeuge bereitstellen. Die Investition in Lehre und Forschung von Seiten der Politik ist somit von entscheidender Bedeutung.
Wie sieht Ihrer Meinung nach die zukünftige Energie-Infrastruktur aus?
Die zukünftigen Netze werden durch eine Vielzahl dezentraler Kraftwerke gespeist, welche als Microgrids im Niederspannungsnetz organisiert sind. Energiespeicher und intelligente Lasten werden in diesen Teilnetzen Flexibilitäten zur Verfügung stellen und sich gegenseitig unterstützen und ergänzen. Dies führt zu einer erhöhten Resilienz und Effizienz des Gesamtsystems. Weiterhin sind Übertragungsnetze der Hoch- und Höchstspannungsnetze für die Gewährleistung einer kontinuierlichen und sicheren Energieversorgung notwendig. Diese sind schon seit Jahrzehnten „intelligent“ und schaffen den großflächigen Ausgleich hoher Leistungen im europäischen Verbund. Zusätzlich werden Energiespeicheranlagen im Mega- und Gigawattbereich eine zwingende Voraussetzung für die CO2-neutrale Energieversorgung sein. In Zeiten niedrigerer Energieerzeugung der regenerativen Kraftwerke können diese auftretende Lastanforderungen der unterlagerten Netze ausgleichen, sodass große fossile Kraftwerke obsolet werden.
Herr Prof. Bodach, wie ist die Forschungslinie „All Electric Society Alliance“ aufgebaut und strukturiert?
Derzeit befinden wir uns noch im Aufbau, sodass feste Strukturen erst noch definiert werden müssen. Mit unseren neun Gründungsmitgliedern, mittlerweile bereits über 60 weiteren Mitgliedern und zahlreichen Teilnahmeanfragen sind wir aber schon eine starke Gemeinschaft. Als Westsächsische Hochschule Zwickau haben wir vorerst den Lead und bereiten derzeit eine eigene Internetpräsenz sowie den Fahrplan für die nächsten Monate und Jahre vor. Wir sind somit zunächst Organisator und Koordinator. Sobald die grundlegende Struktur steht, werden wir mit den Mitgliedern die weitere Organisation, wie Leitung, Arbeitsgruppen usw., abstimmen. Die Allianz ist dabei immer als gemeinsame Plattform sowie Anlaufstelle und Gestaltungswerkzeug zu verstehen. Darüber hinaus soll hier in Zwickau ein Forschungszentrum für die Allianz entstehen, in welchem nutzerakzeptierte Technologien für die All Electric Society entwickelt werden.
Über die All Electric Society Alliance
Die All Electric Society Alliance, initiiert von der Westsächsischen Hochschule Zwickau im Mai 2023, zielt auf die Schaffung einer nachhaltigen, CO2-neutralen Zukunft ab. Diese basiert auf erneuerbarer, elektrischer Energie und integriert Elektrifizierung, Digitalisierung und Automatisierung. Die Allianz strebt eine sektorenübergreifende, interdisziplinäre Zusammenarbeit an, um den Wandel durch Wissenstransfer und effiziente Ressourcennutzung sowie die Entwicklung junger Fachkräfte voranzutreiben. Interessierte Organisationen können der Allianz beitreten, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln und den Übergang zu beschleunigen. Ziel ist ein innovativer, inklusiver Ansatz zur Realisierung einer elektrifizierten, nachhaltigen Gesellschaft.
Partner und Institutionen der All Electric Society Alliance:

![]()

![]()
Projektübersicht mit Bezug zur All Electric Society Alliance
InWaMod
„Verbundvorhaben: lnWaMod – Innovative Wärmeservice-Modelle: Neue Wege aus dem Mieter-Vermieter-Dilemma bei der energetischen Modernisierung“
Projektlaufzeit: 07/2023 – 12/2025
Förderprogramm: 7. Energieforschungsprogramm – Energiewende und Gesellschaft
Inhalte:
- CO2– und Energieeinsparung
- Realisierbarkeit in sozialer, ökonomischer, ökologischer, rechtlicher und technisch Hinsicht zu prüfen
- Mieter zahlt für den Wärmeservice in seiner Wohnung anstatt für die Menge der dafür aufgewendeten Energieträger
- Vermieter spart durch die Wahl der Energieträger und die Ausstattung des Gebäudes
- Mieter spart durch die richtige Regelung von Heizen und Lüften
Z-Move
„Zwickauer Mobilitätsmanagement für berufsbedingte Verkehrsbewegungen 2025 (Z-MOVE 2025); Teilprojekt B: Prototypische Entwicklung eines Mobilitätsmanagementtools“
Projektlaufzeit: 09/2021 – 08/2024
Kooperationspartner: Stadt Zwickau, Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH
Förderprogramm: SOEF-Sozial-ökologische Forschung
Inhalte:
- Mobilitätsmanagement in Form eines Stadtlabors > berufsbedingte Verkehrsströme in Zwickau modellieren
- auf die individuellen Charakteristiken einer Stadt abgestimmtes, lokales Mobilitätstool soll auf das in Phase 1 entwickelte Mobilitätskonzept aufsetzen
ZED
„Verbundvorhaben ZED: Zwickauer Energiewende Demonstrieren – Elektrisch-thermische Verbundsysteme betreiben“
Zeitraum: 11/2017 – 10/2022
Inhalte:
- Ziel: Vergleich der verschiedenen Versorgungssysteme zur Realisierung von Null-Emissionsquartieren
- Fokus nicht nur auf technische Aspekte der Energiewende, auch soziale Gesichtspunkte betrachtet
- Wichtige Themen: demografischer Wandel, Gesundheitsversorgung, Altersarmut, Mobilität
- Zusammenarbeit mit allen wichtigen Akteuren
- intensiver Austausch mit den Bürgern über deren Bedenken, Auswirkung auf das Leben
- „Marienthal Mobil“ = erste Mobilstation der Stadt Zwickau
– eröffnet am 17.07.2020 im Stadtteil Marienthal
– Idee: Sicherung der Mobilität der Einwohner im Alltag
– Fokus auf Menschen, die Hilfe beim Einkauf oder Arztbesuch benötigen
– Ausleihe verschiedener E-Mobile, kostenlos während des Versuchszeitraums
– Unterstützung durch die Alippi GmbH
– an zwei Tagen pro Woche Beratung durch „Quartierlotse“ des Johanniter e.V., auch zu Themen wie Probleme im Wohnumfeld und persönlicher Pflegegrad
– „Mobilbox“: ab Februar 2022 Ausleihe und Rückgabe von E-Scootern 24 Stunden am Tag möglich, dadurch weiter erhöhte Mobilität und Selbstständigkeit
„Umsetzung eines integrierten, quartiersbezogenen Energie- und Klimaschutzkonzeptes für das Gebiet „Am Hochhaus“, Borna“
Zeitraum: 11/2015 – 09/2018;
01/2015 - 09/2020
Auftraggeber: DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Inhalte:
- Gebietsbezogenes integrierten Klimaschutzkonzeptes (KSK)
- Gefördert durch KFW, Stadt Borna als Auftraggeber, in Kooperation mit der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft mbH (BWS)
- Projektpartner: Deutsche Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (DSK), seecon Ingenieure GmbH, Gesellschaft für Intelligente Infrastruktur mbH, Westsächsische Hochschule Zwickau
- Ziel: Vorschläge und Konzepte, um das Quartier in Hinsicht auf Klimaneutralität, Energieeffizienz und Lebensqualität aufzuwerten, erarbeiten und mit Hilfe der Partner umsetzen, zum Beispiel:
- modernere Gehwegbeleuchtung
- abschließbare Fahrradboxen, teils mit Lademöglichkeit
- energetische Optimierung der Kita durch Wärmedämmung
- Hydraulische Optimierung (Hydraulischer Abgleich und Pumpentausch) in zwei Referenzgebäuden
- Geplanter und begonnener Einbau einer Smarten Heizungssteuerung in den zwei hydraulisch optimierten Referenzgebäuden
JenErgieReal
„Reallabor: JenErgieReal – Energieoptimiertes Reallabor Jena mittels in Echtzeit skalierbarer Energiespeicher“
Laufzeit: 10/2022 – 09/2027
Inhalte:
- JenErgieReal versteht sich als „Blaupause“ für die zukünftig ganzheitliche Versorgung mit elektrischer und thermischer Energie sowie der Integration der Mobilität als Bindeglied.
- dabei werden Haupttreiber des Energieverbrauchs Verkehr, Industrie, Gewerbe und Wohnen sektorenübergreifend betrachtet
- JenErgieReal wird als Reallabor der Energiewende die für die deutsche Energiepolitik wesentlichen systemischen Herausforderungen in einem klar umrissenen Großvorhaben exemplarisch angehen und die Rolle der lnfrastrukturbetreiber im Energiewendeprozess verdeutlichen.
- JenErgieReal hat Pioniercharakter für die Transformation des Energiesystems und widmet sich Forschungsfragestellungen, die eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Energiewende einnehmen
- Die Demonstration der Ergebnisse erfolgt als Reallabor in der Stadt Jena.
- Das Teilziel des TP 8 ist dabei die wissenschaftliche Betreuung des in der Verbundvorhabenbeschreibung gestellten Gesamtziels: Die zentralen Themen des Projektes JenErgieReal fokussieren die Netzdienlichkeit und zielen auf die Netzstabilisierung ohne Netzausbau ab
- Als Beispiele seien die Lastspitzenglättung, die Lastensteuerung, auch aus dem vorgelagerten Netz, und die verringerte Rückeinspeisung erwähnt
E-Com
„E-Com – E-Commuter, -munity, -municate – wissenschaftliche Begleitung des Aufbaus von Ladeinfrastruktur in Dresden und Zwickau“
Laufzeit: 10/2019 – 09/2023
Inhalte:
- Durch die gezielte wissenschaftliche Begleitung der kommunalen Einrichtungen sowie der VW Sachsen GmbH soll ein netzverträglicher Ausbau der im Projekt E-COM geplanten Ladeinfrastruktur gewährleistet werden.
- Durch zunehmende Anzahl von Ladesäulen und die größer werdenden Ladeleistungen von Elektrofahrzeugen steigen die Herausforderungen, welche das Versorgungsnetz zu bewältigen hat.
- Um die Kosten für den Ausbau der Energieversorgung dabei möglichst gering zu halten, ist es wichtig, ein intelligentes Lademanagement zu etablieren
- Im Zuge dessen soll eine Netzsimulation der entsprechenden Netztopologie als erweitertes Planungswerkzeug zur Auwahl geeigneter Standorte und Anbindungsmöglichkeiten der Ladeinfrastruktur sowie als Grundlage zur Entwicklung des Lademanagements dienen.
- Eine weitere wichtige Komponente zur Sicherstellung des netzverträglichen Ausbaus der Ladeinfrastruktur stellt die Entwicklung sowie Erprobung von netzdienlichen sowie bidirektionalen Ladesäulen im Bestandsnetz dar
- Auf Basis einer fundierten Vermessung entsprechender Systeme sowie der Realisierung einer zeit- und ortsabhängigen Ladeprognose, angebunden an zentrale Datenplattform der Stadt Dresden soll in enger Zusammenarbeit mit der HTW Dresden ein optimiertes Betriebsregime zur Einbindung netzdienlicher Ladeinfrastruktur in öffentliche Energieversorgungsnetze entwickelt werden.
- Neben der wissenschaftlichen Begleitung bei der Inbetriebnahme, dem Betrieb sowie der Optimierung der Ladeinfrastruktur begleitet die WHZ ebenso den Aufbau des entsprechenden Abrechnungssystems.
WindNODE
„WindNODE – Das Schaufenster für intelligente Energie aus dem Nordosten Deutschlands“
Realisierung der Energiewende im Niederspannungsnetz der Zukunft im Quartier „Marienthal“ der Modellregion Zwickau
Laufzeit: 12/2016 – 03/2021
Inhalte:
- Ziel ist es, in großflächigen „Schaufensterregionen“ skalierbare Musterlösungen für eine umweltfreundliche, sichere und bezahlbare Energieversorgung bei hohen Anteilen erneuerbarer Energien zu entwickeln und zu demonstrieren.
- Im Zentrum stehen dabei die intelligente Vernetzung von Erzeugung und Verbrauch sowie der Einsatz innovativer Netztechnologien und -betriebskonzepte.
- gefundenen Lösungen sollen als Modell für eine breite Umsetzung dienen
Nachwuchsforschergruppe autonomous2grid
- Bestehend aus jungen Nachwuchswissenschaftlern unterschiedlicher Fakultäten
- Untersucht, wie die gespeicherte Energie aus autonom-betriebenen batterieelektrischen Fahrzeugen zur Stabilisierung des Energienetzes genutzt werden kann
- um die Herausforderungen der Mobilitäts- und Energiewende zu bewältigen, wird die vom Freistaat Sachsen und dem europäischen Sozialfond geförderte Nachwuchsforschungsgruppe das automatisierte Fahren und Laden entlang einer neuartigen Prozesskette methodisch untersuchen und gemeinsam geeignete Lösungskonzepte entwickeln.
- Damit liefert autonomous2grid einen entscheidenden Beitrag für das Forschungsgebiet „All Electric Society“ (AES) – einem Zukunftsmodell, das auf die ausschließliche Nutzung regenerativer Energien setzt.
- Im Ergebnis werden einerseits technische Konzepte zur Netzdienlichkeit von autonomen Elektrofahrzeugen erarbeitet
Nachwuchsforschergruppe MetHyMot
- Hocheffizienter Multi‐Fuel‐Motor mit innovativer Sensorik für nachhaltige Mobilität und Energieversorgung (MetHyMot)“
- anwendungsorientierte Forschung an zukunftsweisenden Wasserstofftechnologien
- Konkret soll dabei ein innovatives Motorkonzept entwickelt werden, das speziell auf wasserstoffbasierte Kraftstoffe ausgelegt ist.
- Als mögliche Anwendungsfelder wären wasserstoffbetriebene Blockheizkraftwerke, aber auch Fahrantriebe im On- und Off-Road-Bereich zu sehen
- Interdisziplinäre Forschergruppe aus 7 jungen Nachwuchswissenschaftlern
CC BY-ND 4.0 DE
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#
Sie dürfen:
- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.
Unter den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.
- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.
Aufmacherbild/Quelle/ Lizenz
Das Aufmacherbild des AES-Quartiers ist KI-generiert.
KI weltweit auf dem Durchmarsch, Deutschland gehört zu den Nachzüglern
/in Allgemein, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Studien/von Martina Bartlett-MattisHerausforderungen, ROI, Kosten & Co: Wie wird KI in Unternehmen wirklich eingesetzt? Fivetran und Vanson Bourne präsentieren umfangreiche Studie
München, 21. März 2024 – Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, präsentiert die Ergebnisse einer Umfrage, die zeigt: 81 % der befragten Unternehmen vertrauen ihren KI/ML-Ergebnissen, obwohl sie zugeben, fundamentale Daten-Ineffizienzen zu haben. Sie verlieren im Durchschnitt 6 % ihres weltweiten Jahresumsatzes, bzw. 406 Millionen US-Dollar bei einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar der befragten Unternehmen. Die Ursache sind unzureichende KI-Modelle, die mit ungenauen oder minderwertigen Daten erstellt werden und dadurch zu falschen Geschäftsentscheidungen führen.
Schlusslicht Deutschland
Deutsche Unternehmen stehen noch eher am Anfang der KI-Nutzung (60 %), während das in den USA nur noch 39 %, in Frankreich sogar nur 36 % sind. Dementsprechend sehen sich Unternehmen dort als fortgeschritten: 31 % (USA) bzw. 28 % (Frankreich) nutzen KI, die keine oder kaum menschliche Eingriffe erfordert, wo immer das möglich ist. In Deutschland sind das gerade einmal 14 %.
Insgesamt setzen fast neun von zehn Unternehmen (89 %) KI-/ML-Methoden für die Erstellung von Modellen ein, die automatisch Vorhersagen und Entscheidungen treffen können. 80 % der Unternehmen in den USA und 75 % in Frankreich tun das schon mindestens sechs Monate, in Deutschland sagen das lediglich 44 % von sich.
Auch das Vertrauen in die Ergebnisse einer KI sind in Deutschland gering: Während 30 % der deutschen Unternehmen den Ergebnissen von Generativer KI voll und ganz vertrauen, sagen das 47 % der US-amerikanischen und 48 % der französischen Unternehmen.
Die unabhängigen Marktforschungsspezialisten Vanson Bourne befragten in einer Online-Umfrage 550 Teilnehmer aus Unternehmen mit 500 oder mehr Mitarbeitenden in den USA, Großbritannien, Irland, Frankreich und Deutschland. 100 Teilnehmer kamen aus Deutschland. Die Umfrage ergab, dass fast neun von zehn Unternehmen KI-/ML-Methoden einsetzen, um Modelle für die autonome Entscheidungsfindung zu erstellen. 97 % werden in den nächsten ein bis zwei Jahren in generative KI investieren. Gleichzeitig haben die Unternehmen Probleme mit Datenungenauigkeiten und -Halluzinationen sowie Bedenken hinsichtlich Data Governance und Datensicherheit. US-Unternehmen, die Large Language Models (LLMs) nutzen, berichten in 50 % der Fälle von Datenungenauigkeiten und -Halluzinationen.
„Die schnelle Verbreitung von generativer KI spiegelt einen weit verbreiteten Optimismus und eine Zuversicht in den Unternehmen wider. Aber unter der Oberfläche gibt es immer noch grundlegende Datenprobleme, die Unternehmen daran hindern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen“, erklärt Taylor Brown, Mitbegründer und COO von Fivetran. „Unternehmen müssen ihre Datenintegrations- und -Governance-Grundlagen stärken, um zuverlässigere KI-Ergebnisse zu erzielen und finanzielle Risiken zu minimieren.“
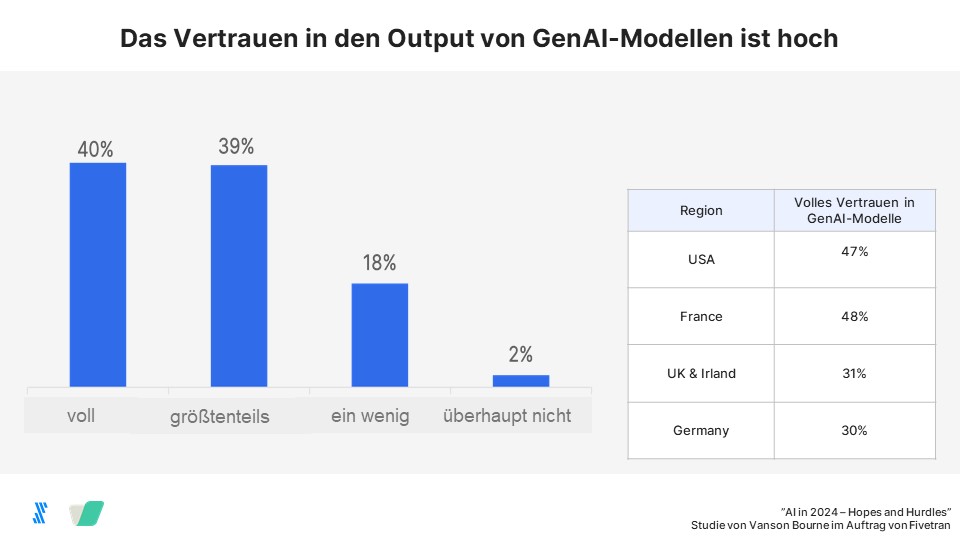
Unterschiedliche „KI-Realitäten“ in verschiedenen Berufsrollen
Etwa jedes vierte Unternehmen (24 %) gab an, ein fortgeschrittenes Stadium der KI-Nutzung erreicht zu haben, in dem es die Vorteile der KI voll ausschöpft und nur noch wenig oder gar nicht mehr auf menschliche Eingriffe angewiesen ist. Allerdings gibt es erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den Befragten: Technische Führungskräfte, die KI-Modelle entwickeln und betreiben, sind von der KI-Reife ihrer Unternehmen weniger überzeugt. Von ihnen bezeichnen nur 22 % sie als „fortgeschritten“, verglichen mit 30 % der nicht-technischen Mitarbeitenden. Anders bei generativer KI: Ihr vertrauen 63 % der nicht-technischen Mitarbeitenden vollständig, bei den technischen Führungskräften sind es 42 %.
Eine weitere Uneinigkeit besteht zwischen den Datenexperten auf unterschiedlichen Führungsebenen eines Unternehmens: Während die in Junior-Positionen veraltete IT-Infrastrukturen als größtes Hindernis für die Entwicklung von KI-Modellen sehen (49 %), sehen leitende Kollegen das Hauptproblem darin, dass sich Mitarbeitende mit den richtigen Fähigkeiten auf andere Projekte konzentrieren (51 %). Tatsächlich sind diese gezwungen, ihre Ressourcen für manuelle Datenprozesse wie die Bereinigung von Daten und die Reparatur defekter Datenpipelines zu nutzen. Unternehmen geben zu, dass ihre Data Scientists den Großteil (67 %) ihrer Zeit mit der Aufbereitung von Daten verbringen, anstatt KI-Modelle zu erstellen.
Schlechte Datenpraktiken sind immer noch weit verbreitet
Die Ursache für das vergeudete Potenzial von Datenspezialisten und die unzureichende Performance von KI-Programmen ist dieselbe: unzugängliche, unzuverlässige und falsche Daten. Wie groß das Problem ist, zeigt die Tatsache, dass die meisten Unternehmen Schwierigkeiten haben, auf alle Daten zuzugreifen, die für die Ausführung von KI-Programmen benötigt werden (69 %) und diese in ein brauchbares Format zu bringen (68 %).
Neue Ansätze bei generativer KI haben weitere Komplikationen mit sich gebracht: 42 % der Befragten hatten schon mit Datenhalluzinationen zu tun. Diese können zu schlechten Entscheidungen führen, da die Informationsbasis mangelhaft ist. Sie verringern das Vertrauen in LLMs oder die Bereitschaft der Mitarbeitenden, das Tool zu nutzen. Zudem rauben sie viel Zeit für das Auffinden und Korrigieren der Daten. Angesichts der Tatsache, dass 60 % der leitenden Angestellten generative KI nutzen und für strategische Entscheidungen verantwortlich sind, werden Probleme mit der Qualität und Vertrauenswürdigkeit der Daten noch verstärkt.
Data Governance als Schlüsselbereich für den Einsatz von KI
Die Befürchtungen hinsichtlich des Einsatzes generativer KI bleiben ebenfalls bestehen, wobei „die Aufrechterhaltung der Data Governance“ und „finanzielle Risiken aufgrund der Sensibilität der Daten“ die größten Bedenken der Unternehmen sind (37 %). Solide Data-Governance-Grundlagen sind besonders wichtig für Unternehmen, die entweder eigene generative-KI-Modelle entwickeln oder eine Kombination aus bestehenden externen sowie intern entwickelten Modellen verwenden wollen. Da jedoch die Mehrheit (67 %) der Befragten den Einsatz neuer Technologien plant, um grundlegende Datenbewegungen, Governance- und Sicherheitsfunktionen zu stärken, gibt es Grund zum Optimismus.
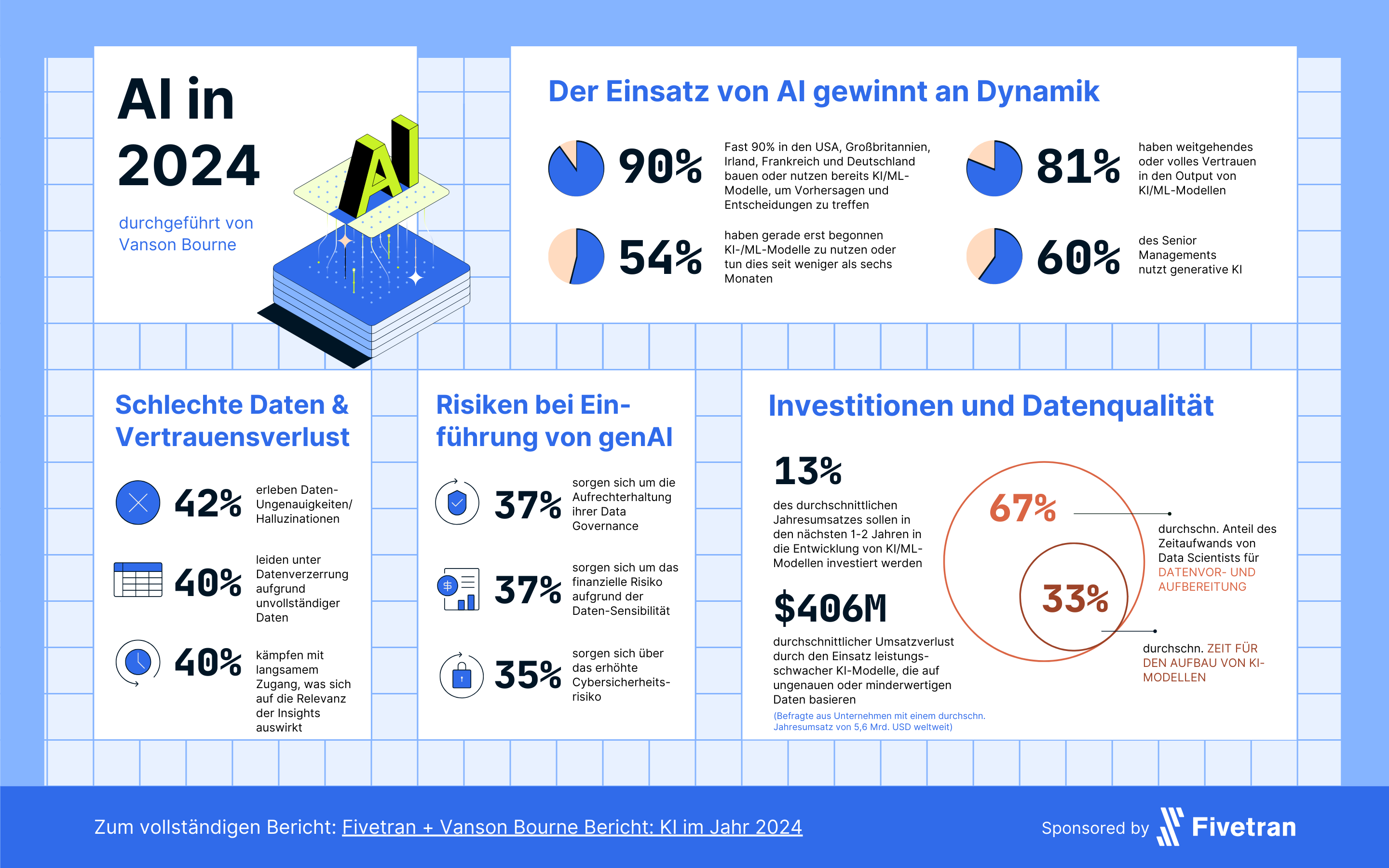
Der vollständige Bericht steht unter Fivetran + Vanson Bourne report: AI in 2024 zum Download.
Mehr Informationen, wie sich Daten für generative KI fit machen lassen, enthält das Fivetran e-Book.
Aufmacherbild / Quelle / Lizenz
Image by Gerd Altmann from Pixabay
36 Millionen Euro Series B-Finanzierung für Eye Security
/in Ausgaben, Sicherheit/von Martina Bartlett-MattisJ.P. Morgan investiert in die IT-Sicherheit des Deutschen Mittelstands
Eye Security will den Deutschen Mittelstand umfassend vor Cybersicherheitsrisiken schützen. Dazu erhält das Startup eine Series B-Finanzierung in Höhe von 36 Millionen unter der Führung von J.P. Morgan Growth Equity Partners. Mit der Finanzierung wird die Präsenz in Deutschland ausgebaut sowie die weitere Expansion nach Europa vorangetrieben.
Eye Security wurde 2020 von einem Team niederländischer Geheimdienst- und Sicherheitsexperten mit der Mission gegründet, den europäischen Mittelstand vor Cyberattacken zu schützen. Seitdem ist das Team auf über 100 Fachleute gewachsen, Eye Security ist in Deutschland, den Niederlanden und Belgien aktiv und bedient Hunderte Kunden aus unter anderem der Automobilindustrie, dem verarbeitenden Gewerbe, dem Gesundheitswesen, dem Finanzdienstleistungssektor und der Informationstechnologie.
Die Series B-Finanzierung unter der Führung von J.P. Morgan Growth Equity Partners mit Beteiligung der bestehenden Investoren Bessemer Venture Partners und TIN Capital wird genutzt, um die Marktstellung in Deutschland, den Niederlanden und Belgien auszubauen und die Expansion in weitere europäische Länder voranzutreiben. Die Vision: Dem Deutschen Mittelstand die Cybersicherheit zur Verfügung stellen, die eine starke Deutsche Wirtschaft benötigt.
Die Vision: Dem Deutschen Mittelstand die Cybersicherheit zur Verfügung stellen, die eine starke Deutsche Wirtschaft benötigt.
Eye Security geht massive Sicherheitsprobleme im Mittelstand an
Der Markt für Cybersicherheit ist groß, der Bedarf an passenden Lösungen für den Mittelstand ebenfalls – denn dieser ist nicht nur Treiber der Deutschen und Europäischen Wirtschaft, sondern auch besonders stark von IT-Sicherheitsrisiken betroffen. Alleine der Deutsche Markt hat ein Volumen von 10 Milliarden Euro, der Europäische Markt eines von 34 Milliarden Euro. In Deutschland soll das Volumen bis 2029 auf 18 Milliarden Euro anwachsen, in Europa sogar auf 60 Milliarden. Dabei nimmt Eye Security den Mittelstand in den Fokus, denn trotz des stark wachsenden Marktes fließt ein Großteil der Ausgaben in den Schutz von Großunternehmen – dabei entfallen etwa 50 Prozent aller Cyber Security- Angriffe auf mittelständische Unternehmen, von denen rund 60 Prozent im Falle eines Hacks so geschädigt sind, dass sie ihr Geschäft aufgeben müssen.
J.P. Morgan Growth Equity Partners als starker Partner
Das Potenzial von Eye Security erkennt auch J.P. Morgan Growth Equity Partners: „Eye Security füllt eine kritische Lücke in der Bereitstellung von fortschrittlicher Cybersicherheitslösungen für mittelständische Unternehmen. Diese sind nach wie vor enorm von Zwischenfällen betroffen und verfügen nicht über die notwendigen Fähigkeiten, um auf Vorfälle zu reagieren. Gerade im Zusammenhang mit der bevorstehenden NIS2-Richtlinie
der Europäischen Union und dem anhaltenden Mangel an Fachkräften im Bereich der Cybersicherheit glauben wir, dass Eye Security gut positioniert ist, um diese Lücke zu schließen. Wir freuen uns, die Mission zu unterstützen”, so Christopher Dawe, Managing Partner
bei J.P. Morgan Growth Equity Partners.
NIS2-Richtlinie verstärkt Notwendigkeit robuster Cybersicherheitsmaßnahmen
Die Unterstützung durch Unternehmen wie Eye Security gewinnt vor allem mit der Umsetzung der NIS2-Richtlinie der Europäischen Union enorm an Bedeutung. Die Richtlinie sieht für Unternehmen strenge Fristen für die Meldung von Sicherheitsverletzungen an ihre jeweilige Regierungsbehörde vor und EU-Mitgliedsstaaten müssen sie bis zum 17. Oktober 2024 in die nationale Cybersicherheitsgesetzgebung ihres Landes umsetzen.
Die Nichteinhaltung kann zu Geldstrafen von bis zu 10 Millionen Euro oder zirka 2 Prozent des gesamten weltweiten Jahresumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr führen. Aufsichtsbehörden und Beratungsfirmen empfehlen Unternehmen, ihre Cybersicherheit zu verbessern, indem sie Verfahren für den Umgang mit Vorfällen entwickeln, Mitarbeiter schulen und weitere Vorkehrungen treffen.
„Unsere Reise begann mit der Vision, die eskalierenden Cyber-Risiken zu bekämpfen, mit denen Unternehmen täglich konfrontiert sind“, sagt Job Kuijpers, CEO von Eye Security. „Wir freuen uns, unsere Mission auf ganz Europa auszuweiten und unseren Kunden und strategischen Partnern die Gewissheit zu geben, dass sie mit einem führenden Unternehmen im Bereich Cybersicherheit und Versicherung zusammenarbeiten.“
Dazu bietet Eye Security ein Komplettpaket inklusive 24/7 Managed XDR-Lösungen, Incident Response, Cybersicherheitsschulungen für Mitarbeiter und eine zuverlässige Cyber-Versicherung.
Aufmacherbild / Quelle / Lizenz
Image by CoolVid-Shows from Pixabay
Mit Graphtechnologie gegen den Weltraumschrott
/in Allgemein, Data Science, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit/von Martina Bartlett-MattisVortrag auf der SXSW 2024
Das South by Southwest (SXSW) in Austin gilt als größtes Technologie- und Kreativfestival der Welt. Bei den Key Notes, Panel Diskussionen, Workshops und Meetups der SXSW Conference ging es auch um die Zukunft des Weltraums. In ihrem Vortrag How the Tech That Tracks Space Junk Will Save Life on Earth sprachen Weltraum-Aktivist Dr. Moriba Jah und Sudhir Hasbe von Neo4j über die zunehmende Vermüllung des Erdorbits.
In der Erdumlaufbahn wird es eng
Wie der Sturzflug des ausrangierten Batteriesets der ISS erst kürzlich zeigte, ist die Gefahr von Weltraumschrott durchaus real. Und steigt mit zunehmender Abhängigkeit der Gesellschaft von Satelliten und den damit verbundenen Diensten rund um Kommunikation, Ortung und Klimaüberwachung. Der Weltraum ist stark verschmutzt.
 Dr. Moriba Jah (li) und Sudhir Hasbe auf der SXSW 2024
Dr. Moriba Jah (li) und Sudhir Hasbe auf der SXSW 2024
Dr. Moriba Jah, Assistenzprofessor für Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität von Austin:
„1957 schickten wir mit Sputnik den ersten Satelliten in die Umlaufbahn. Heute verzeichnen wir mehr als 50.000 Objekte unterschiedlicher Größe, die um die Erde kreisen. 5.000 davon sind tatsächlich noch funktionierende Satelliten. Elon Musk schickt fast jede Woche weitere Systeme in den Weltraum.“
Mit der Privatisierung des Weltraums (z. B. Starlink, Project Kuiper) und dem Trend rund um Weltraumtourismus verschärft sich das Platzproblem im Orbit weiter. Zusammenstöße könnten bald eher die Regel als die Ausnahme sein. Im Sommer letzten Jahres musste die Internationale Raumstation (ISS) gleich zweimal in einem Monat entgegenkommenden Objekten ausweichen.
Raumfahrt Startup mit Tracking-App
Dr. Moriba Jah setzt sich seit Jahren mit diesem Problem auseinander. Er ist außerdem Mitgründer und Chief Scientist des Raumfahrt-Startups Privateer. Das Unternehmen entwickelte die Tracking-App Wayfinder, die Satelliten im Orbit verortet und mögliche Kollisionen berechnet. Die „Google Maps“ für das Weltraum soll zukünftig die Sicherheit von Weltraumdiensten verbessern und Aufräumarbeiten erleichtern.
Zu den prominenten Mitstreitern des Startups gehören Apple Mitbegründer Steve Wozniak und Tech-Pionier Alex Fielding. Privateer sieht sich als erste KI-gestützte Informationsplattform in der Raumfahrt. Ziel ist es, Daten über die aktuelle „Verkehrslage“ im Orbit zu sammeln und Satellitenbetreibern zur Verfügung zu stellen. Erste Testversuche mit dem Satellitenaufsatz Pono dazu starteten im Januar.
Im SXSW-Panel erklärte Dr. Moriba Jah, wie Wayfinder Satelliten und Trümmerteile visualisiert (siehe Screenshot):
„Jeder Punkt in dieser Ansicht ist ein von Menschen geschaffenes Objekt, das momentan die Erde umkreist. Dazu gehören sich im Betrieb befindliche Weltraumgeräte (blaue Punkte), aber eben auch Weltraumschrott (rosa Punkte). Die Ellipse wurde durch ein Super-Spreader-Ereignis erzeugt – alle Punkte darin stellen Trümmer von explodierenden oder kollidierten Objekten dar. Wenn diese auf einen Satelliten treffen,
ist das Spiel aus.“
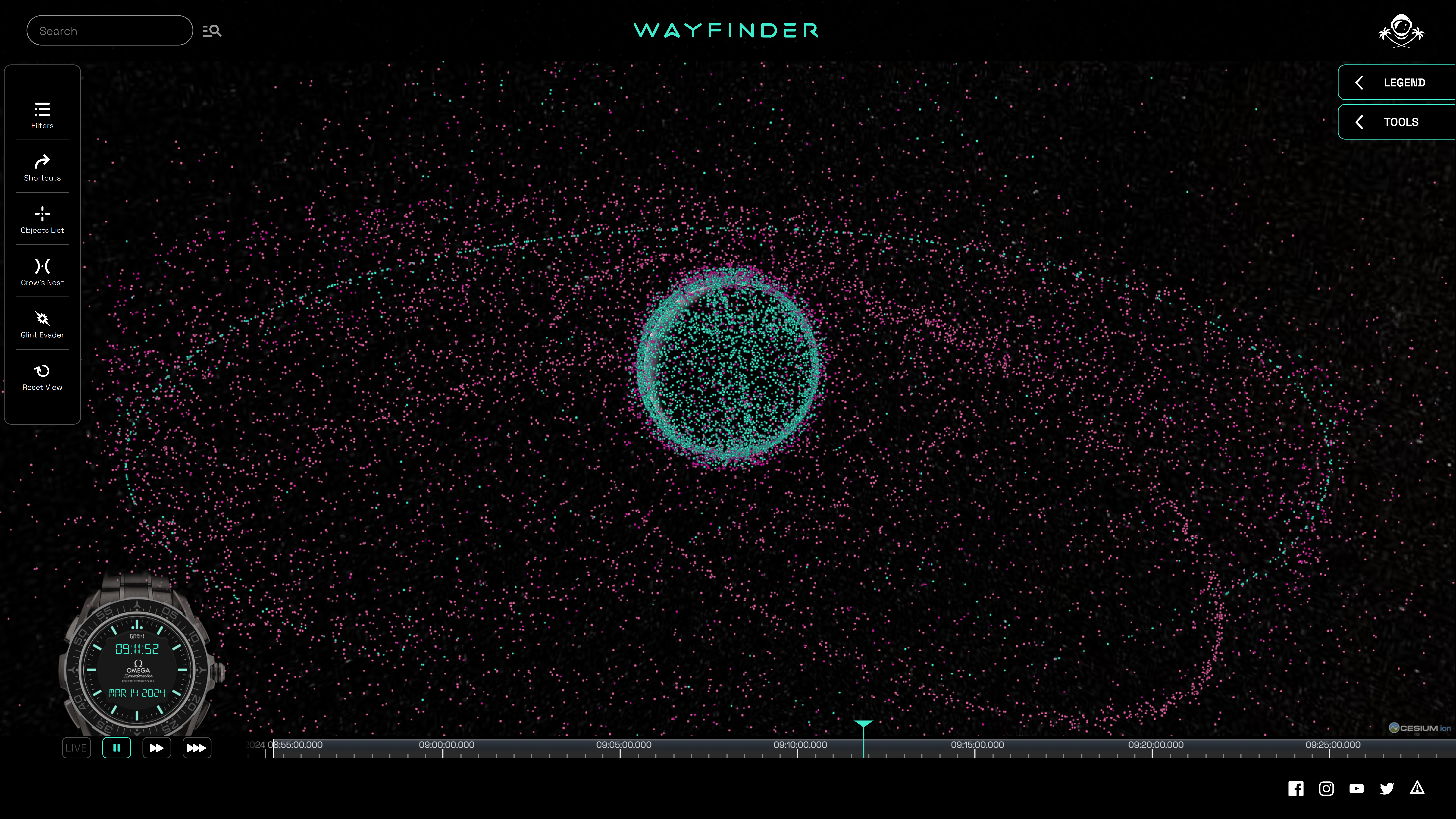
Screenshot der Wayfinder Tracking-Lösung (Quelle: Privateer)
Visualisierung im Graphen
Im Rahmen des SXSW-Panels warf Graph-Experte Sudhir Hasbe einen Blick auf die Technologie hinter Wayfinder. Die Tracking-Lösung nutzt die Graphdatenbank Neo4j, um Satelliten sowie Trümmerteile in der Erdumlaufbahn in nahezu Echtzeit zu visualisieren. Auf Grund des Datenmodells lassen sich Flugbahnen berechnen, Zusammenstöße vorhersagen sowie Umweltverschmutzer im Weltraum identifizieren.
Sudhir Hasbe, Chief Product Officer bei Neo4j:
„Die Welt ist vernetzt. Unsere Daten aber befinden sich in der Regel in Silos. Jeder verfügt über eine Vielzahl an Daten. Wenn man jedoch diese ganzen Informationen nicht zusammenführen und verknüpfen kann, ist es extrem schwer solche gewichtigen Probleme wie die Verschmutzung des Weltraums gemeinsam anzugehen.“
Graphdatenbanken sind darauf ausgelegt, komplexe, stark vernetzte Daten abzubilden und zu analysieren. Die realitätsnahe Visualisierung ermöglicht dabei einen einfachen, intuitiven Zugang. Was den Austausch und offenen Zugang an Informationen angeht, steht die Raumfahrtindustrie allerdings noch am Anfang. Denn derzeit können nur Regierungen und Privatunternehmen auf umfassende Satelliten- und Weltraumdaten zugreifen.
Ein anderes Thema, das in der Raumfahrt verstärkt in den Vordergrund rückt, ist Nachhaltigkeit. Viele der Satelliten- und Raketenteile sind Einwegprodukte. Im Sinne einer Kreislaufwirtschaft gilt es also, Lösungen für das Recyclen und die Entsorgung zu finden. Zudem müssen auch Satellitenbetreiber gesetzliche Auflagen erfüllen. So verhing die USA-Behörde FCC im letzten Oktober erstmals eine Strafe gegen einen Betreiber, der einen ausgedienten Satelliten nicht aus der Umlaufbahn entfernte.
Weitere Informationen:
https://neo4j.com / https://www.privateer.com/
Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie: Wie KI die Innovationskraft von Firmen steigern wird
/in Künstliche Intelligenz, Unternehmen & Märkte/von Martina Bartlett-MattisGastbeitrag von Bernd Wagner, Managing Director bei Google Cloud in Deutschland
Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der (generativen) Künstlichen Intelligenz stellen für Wirtschaft und Gesellschaft einen Wendepunkt dar. Das zeigt sich unter anderem an dem enormen Potenzial für die Weltwirtschaft: Laut dem McKinsey Global Institute kann die Technologie einen jährlichen Produktivitätszuwachs von 2,6 bis 4,4 Billionen US-Dollar liefern. Eine Studie des Statistischen Bundesamts aus dem Herbst 2023 ergab, dass etwa jedes achte Unternehmen in Deutschland Künstliche Intelligenz im Allgemeinen bereits nutzt. Unter den Großunternehmen sind es sogar 35 Prozent.
„Künstliche Intelligenz ist schon heute für fast jeden Unternehmensbereich relevant und eröffnet unter anderem neue Wege für Marktanalyse, Entscheidungsfindung und Produktentwicklung.“
Das verwundert kaum, denn Künstliche Intelligenz ist schon heute für fast jeden Unternehmensbereich relevant und eröffnet unter anderem neue Wege für Marktanalyse, Entscheidungsfindung und Produktentwicklung. Ihre transformative Wirkung reicht von der Automatisierung von zeitaufwändigen Routineaufgaben bis hin zur Bereitstellung detaillierter Einblicke in relevante KPIs. Dabei nicht zu vergessen sind auch die ethischen Aspekte der KI-Nutzung und ihre Bedeutung für den Aufbau eines nachhaltigen und zukunftsorientierten Geschäftsmodells. Kurzum: KI hat das Potenzial nicht nur die Geschäftswelt, sondern auch unsere Gesellschaft in ihrer gesamten Breite zu verändern.
Einsatz von Künstlicher Intelligenz für Marktanalyse und Prognose
Die Integration von KI in die Marktanalyse erlaubt es Unternehmen, ein tiefgreifendes Verständnis für dynamische Markttrends und Kundenpräferenzen zu entwickeln. Moderne KI-Systeme sind in der Lage, umfangreiche Daten aus verschiedenen Quellen zu verarbeiten. Diese Fähigkeit, komplexe Muster in Daten zu erkennen und zu interpretieren, ist entscheidend für die Vorhersage zukünftiger Markttrends. So können Unternehmen nicht nur bestehende Märkte besser bedienen, sondern auch potenzielle neue Absatzmärkte identifizieren.
Darüber hinaus machen es KI-gestützte Prognosemodelle möglich eine genauere Vorhersage von Verbraucher*innenverhalten und Marktentwicklungen zu antizipieren. Dies ist besonders nützlich in schnelllebigen Branchen, in denen das frühzeitige Erkennen von Trends einen erheblichen Wettbewerbsvorteil darstellt. Durch den Einsatz von KI in der Marktanalyse können Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen effektiver an die Bedürfnisse ihrer Kund*innen anpassen und somit ihre Position stärken. Auch wenn die Vorteile greifbar sind: Deutsche Entscheider*innen im Bereich Markt- und Meinungsforschung sind laut einer aktuellen Civey-Studie noch zögerlich hinsichtlich der Implementierung der Technologie. So sehen 14,5 Prozent der Befragten KI eindeutig als Chance, und 25,6 Prozent nehmen die Technologie „eher als Chance“ wahr. Gleichzeitig ist KI für 29,4 Prozent beides gleichermaßen, eine Chance und ein Risiko.
„Durch die Nutzung von KI-basierten Tools können Mitarbeiter*innen außerdem ihre Fähigkeiten erweitern und ihre Kreativität in Bereichen einsetzen, die das Unternehmen voranbringen und zur Aufbrechung starrer Strukturen beitragen. „
Automatisierung und Kreativitätsförderung
KI hat das Potenzial, die Arbeitswelt grundlegend zu verändern, indem sie repetitive und zeitaufwendige Aufgaben automatisiert. Diese Entlastung von Routinearbeiten schafft Freiräume für Mitarbeiter*innen, sich auf kreativere und wertschöpfendere Aufgaben zu konzentrieren. Beispielsweise kann KI im Kundendienst genutzt werden, um häufig gestellte Fragen automatisch zu beantworten, während sich die Fachkräfte auf komplexe Kundenanfragen konzentrieren. Dies führt nicht nur zu einer effizienteren Arbeitsweise, sondern erhöht auch die Mitarbeiter*innenzufriedenheit und ihre Bindung an das eigene Unternehmen.
Darüber hinaus kann KI in der Datenanalyse eingesetzt werden, um Muster und Erkenntnisse zu extrahieren, die menschlichen Analyst*innen entgehen würden. Diese tiefgreifenden Einblicke können Unternehmen dabei helfen, innovative Ansätze für Problemlösungen und neue Geschäftschancen zu entwickeln. Durch die Nutzung von KI-basierten Tools können Mitarbeiter*innen außerdem ihre Fähigkeiten erweitern und ihre Kreativität in Bereichen einsetzen, die das Unternehmen voranbringen und zur Aufbrechung starrer Strukturen beitragen. Dadurch wird nicht nur die individuelle Arbeitsleistung gesteigert, sondern auch die gesamte Innovationsfähigkeit des Unternehmens gefördert. Wie dringend dies nötig ist, zeigt eine aktuelle Studie von IW Consult und der Bertelsmann Stiftung: Demnach bezeichnet sich nur jeder fünfte deutsche Betrieb als innovativ. 2019 war es noch jedes vierte Unternehmen. Insgesamt verringerte sich die Innovationsleistung der deutschen Wirtschaft seit 2019 um 15 Prozent. Für die Bewertung der Innovationsleistung wurden Firmen befragt, inwieweit sie Produkt-, Prozess-, Marketing- oder Geschäftsmodell-Innovation umgesetzt haben.
Ein Beispiel für Innovationskraft dank KI: Ein renommierter deutscher Retailer setzt auf einen Einkaufsassistenten, der mittels generativer KI Kundenfragen binnen von Sekunden beantwortet. Dabei werden die Bewertungen vorheriger Käufer*innen mit berücksichtigt. Nicht selten hat ein gesuchtes Haushaltsprodukt mehr als 1.000 Kundenrezensionen. Diese Masse bei der eigenen Kaufentscheidung mit zu berücksichtigen ist für einen Menschen kaum machbar. Der KI-Assistent hingegen kann in Sekunden etwa alle Vor- und Nachteile zusammenfassen und sicherstellen, dass potenzielle Käufer*innen exakt die Informationen bekommen, die sie wirklich für ihre Entscheidungsfindung benötigen.
Beschleunigung der Produktentwicklung
Die Implementierung von Künstlicher Intelligenz in den Produktentwicklungsprozess ist ein Game-Changer für Unternehmen. KI-gestützte Werkzeuge können den Design- und Entwicklungsprozess erheblich beschleunigen, indem sie präzise Vorhersagen und Analysen liefern. Zum Beispiel können KI-Algorithmen genutzt werden, um die Leistungsfähigkeit und Marktrelevanz neuer Produkte zu simulieren, was zu einer schnelleren und effizienteren Produktentwicklung führt. Dies reduziert nicht nur die Zeit und die Kosten, die mit traditionellen Entwicklungsmethoden verbunden sind, sondern hilft auch dabei, Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Ein weiterer Vorteil der KI in der Produktentwicklung ist die Fähigkeit, frühzeitig Hürden und Fehljustierungen zu identifizieren. Durch die Analyse von Prototypen und Testdaten kann KI potenzielle Probleme erkennen, bevor sie in der Produktionsphase auftreten. Diese proaktive Fehlerbehebung hilft Unternehmen, kostspielige Rückrufaktionen zu vermeiden und die Qualität ihrer Produkte zu verbessern. Schließlich ist es besser aus Fehlern zu lernen, bevor man sie überhaupt macht.
„Eine ethische Herangehensweise an KI führt dazu, dass Mitarbeiter*innen sich stärker mit den Werten ihres Unternehmens identifizieren, was wiederum zu einer positiven Unternehmenskultur und einer verbesserten Mitarbeiter*innenbindung führt.“
KI in der Entscheidungsfindung
KI-Technologien revolutionieren nicht zuletzt die Entscheidungsfindung in Unternehmen. Durch die Verarbeitung und Analyse großer Datenmengen können KI-Systeme wertvolle Insights bieten, die Entscheidungsträger*innen unterstützen. Diese Systeme können Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen und analysieren, um Trends, Muster und Korrelationen aufzudecken, die sonst möglicherweise übersehen würden. Ausgerüstet mit diesen Erkenntnissen können Führungskräfte fundiertere Entscheidungen treffen, die auf realen Daten und nicht nur auf Intuition basieren. KI-gestützte Entscheidungshilfen helfen Unternehmen somit dabei, Risiken besser zu bewerten und Chancen zu erkennen. Dies führt zu einer informierten strategischen Planung und einer effizienteren Ressourcenallokation. Indem Unternehmen datenbasierte Entscheidungen treffen, können sie sich schneller an verändernde Marktbedingungen anpassen und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken.
Ethische Nutzung von KI
Die ethische Nutzung von KI ist für den langfristigen Erfolg von Unternehmen unerlässlich. Es ist wichtig, dass Unternehmen bei der Implementierung von KI-Technologien ethische Grundsätze berücksichtigen, um das Vertrauen ihrer Kund*innen und der Öffentlichkeit nicht zu beschädigen. Dies umfasst die Gewährleistung der Transparenz von KI-Entscheidungen, die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und die Sicherstellung, dass KI-Systeme keine Vorurteile oder Diskriminierung fördern. Unternehmen, die ethische Überlegungen in den Mittelpunkt ihrer KI-Strategie stellen, können nicht nur ihr Image verbessern, sondern auch eine stärkere Kundenbindung erzielen. Darüber hinaus führt eine ethische Herangehensweise an KI dazu, dass Mitarbeiter*innen sich stärker mit den Werten ihres Unternehmens identifizieren, was wiederum zu einer positiven Unternehmenskultur und einer verbesserten Mitarbeiter*innenbindung führt.
Fazit
Künstliche Intelligenz bietet Unternehmen eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihre Innovationskraft zu steigern. Von der Marktanalyse über die Automatisierung und Kreativitätsförderung bis hin zur Beschleunigung der Produktentwicklung und Verbesserung der Entscheidungsfindung – die Vorteile von KI sind vielfältig. Gleichzeitig ist es entscheidend, dass Unternehmen die ethischen Aspekte der KI-Nutzung berücksichtigen, denn nur dann können sie das volle Potenzial dieser Technologie nutzen und nachhaltig erfolgreich sein. KI ist ein mächtiges Werkzeug. Verantwortungsvoll eingesetzt hat sie das Potenzial, den gesamten Wertschöpfungsprozess grundlegend zu revolutionieren.
Aufmacherbild /Quelle / Lizenz
Image by Gregor Mima from Pixabay
Digitale Neugier
/in Allgemein, Digitalisierung/von Martina Bartlett-MattisGastbeitrag von Nina Herten und Jens Becker
„Digitale Neugier” als Mitarbeiterkompetenz: Entscheidender Faktor in der Transformation im Mittelstand
Die digitale Transformation ist ein unaufhaltsamer Wandel, der Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen betrifft. Studien und Umfragen konzentrieren sich häufig auf den Stand der Digitalisierung der deutschen Wirtschaft. Sie kommen immer wieder zu dem Ergebnis, dass kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) die Möglichkeiten der Digitalisierung nicht ausreichend erkennen und umsetzen – und das obwohl digitale Transformationsprojekte sich häufig durch einen unmittelbaren Effizienzgewinn und einen klar messbaren Return on Investment auszeichnen und somit eine klare, positive ökonomische Perspektive sind. Eine erfolgreiche digitale Transformation der Wirtschaft erfordert eine systematische Digitalisierung der KMU, immerhin machen KMU 99,4 Prozent des Unternehmensbestands in Deutschland aus (Quelle: Bundesnetzagentur).
In diesem Kontext hebt LEVACO Chemicals, ein mittelständisches Chemieunternehmen, nicht nur die technologischen Aspekte der digitalen Transformation hervor, sondern setzt einen klaren Fokus auf den oft übersehenen, aber entscheidenden Faktor Mensch.
„Inmitten von Fachkräftemangel und dem Bestreben, die Kostenstruktur im Blick zu behalten, wird der intelligente Einsatz digitaler Lösungen zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor.“
Wertschöpfung durch Digitalisierung steigern
Insbesondere für wachsende mittelständische Unternehmen stellt die Digitalisierung im Verwaltungsbereich einen der wichtigsten Hebel dar, um in der Organisation die Basis zur Bewältigung immer breiter werdender Aufgabenspektren und Prozesse zu gewährleisten. Inmitten von Fachkräftemangel und dem Bestreben, die Kostenstruktur im Blick zu behalten, wird der intelligente Einsatz digitaler Lösungen zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor.
Ein konkretes Beispiel aus dem Bereich Kundenmanagement verdeutlicht die Relevanz: In der Anfangsphase von Unternehmen – bei kleinen Teams und überschaubaren Vertriebsaktivitäten – genügen pragmatische Excel-Listen und das Controlling als zentraler Ansprechpartner für Auswertungen aller Art. Mit zunehmender Komplexität, Geschäftswachstum und Internationalisierung steigt jedoch der manuelle Aufwand für Analysetätigkeiten überproportional. Intelligente CRM- und Analysesysteme ermöglichen die Bewältigung dieser manuellen Tätigkeiten und schaffen so Kapazitäten für zusätzliche Aufgaben, die durch das Wachstum entstehen. Nicht-wertschöpfende Tätigkeiten werden somit von digitalen Tools übernommen und lassen mehr Zeit für Kunden- und Projektbetreuung – trotz gleichbleibendem Overhead.
Durch die Einführung der cloud-basierten CRM Lösung von SAP bei der LEVACO gelingt es, alle Schlüsselinformationen zu Kunden, Projekten und möglichen Potentialen an einer zentralen Stelle digital und 24/7 zur Verfügung zu stellen. Gerade neue Mitarbeitende schätzen die Möglichkeiten, sich auf Basis der im System vorhandenen Informationen schnell befähigt zu werden, in das operative Tagesgeschäft einzusteigen. Durch den „Single-Point-of-Truth“ und eine nahtlose Integration in des ERP System, entfällt nach weniger als einem Jahr nach Go-Live ein Großteil der manuellen Auswertungen, da diese im System einsehbar sind und Standard-Analysen durch einfache Filter und nutzerfreundliche Bedienbarkeit selbst erstellt werden können. Selbstverständlich werden durch intelligente Berechtigungssysteme und DSGVO-konformer Ablage dabei auch die Sicherheitskriterien an ein solches System erfüllt.
Bei der Implementierung dieser Lösung wurde im laufenden Prozess deutlich, dass es dabei nicht nur auf die technologischen Aspekte selbst ankommt – auch das frühzeitige Einbinden der Mitarbeitenden in die Entwicklung der Lösung sowie kontinuierliche Schulung sind zwingend notwendig, um solche Tools effizienzsteigernd zu implementieren.
Dabei wird deutlich, dass die „digitale Neugier“ der Mitarbeitenden zum Erfolgsfaktor zählt. Angestellte sollen nicht nur passive Konsumenten von Lösungen sein, sondern aktive Gestalter digitaler Innovationen. Ein Schlüsselelement ist dabei die digitale Affinität der Mitarbeitenden. Diese wird als unerlässlich betrachtet, um Abteilungsprozesse erfolgreich zu digitalisieren und somit die Grundvoraussetzung für eine gelungene Transformation zu schaffen.
„Anstatt Anforderungen dezidiert in überbürokratisieren Lasten- und Pflichtenheften festzulegen, erfordert die Implementierung digitaler Tools eine agile Herangehensweise:“
Digitalisierung erfordert ein Umdenken
Der digitale Transformationsprozess nimmt eine beträchtliche Zeitspanne in Anspruch. Projekte werden häufig nicht zeitgerecht abgeschlossen, und digitale Lösungen werden mitunter in unzureichender Qualität bereitgestellt. Diese Verzögerungen haben nicht nur Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden hinsichtlich der digitalen Lösungen, sondern werfen auch ein Licht auf grundlegende Herausforderungen.
Die Ursachen dafür liegen häufig in der traditionellen Herangehensweise bei der Entwicklung neuer, digitaler Lösungen. Anstatt Anforderungen dezidiert in überbürokratisieren Lasten- und Pflichtenheften festzulegen, erfordert die Implementierung digitaler Tools eine agile Herangehensweise: Gemeinsam erarbeitet das Projektteam in Iterationen Stück für Stück ein Lösungskonzept was die Bedürfnisse des Users in den Vordergrund stellt. So ist es möglich, während der Entwicklung von Systemen auf neue Anforderungen flexibel reagieren zu können, anstatt sich an starre, festgelegte Strukturen und Anforderungen zu halten.
Diese Herangehensweise erfordert auch, dass die Mitarbeitenden in so einem Projektteam Zeiträume haben, um sich mit dem Tool zu beschäftigen und ihre Anforderungen klar formulieren zu können. Fehlende „digitale Kompetenz“ führt außerdem häufig zu einer Informationsasymmetrie und Missverständnissen zwischen der IT und den Nutzenden.
Um die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen und als Learning aus vergangenen Projekten, setzt die LEVACO auf die Entwicklung eines Rahmenwerks für die Umsetzung von agilen Projekten und unterstützt die Organisation durch ein zentrales Projektmanagement sowie Key User und Product Owner in den Fachbereichen.
„Daher sollten Unternehmen bei der Digitalisierung im Blick haben, dass Mitarbeitende diese Kompetenzen mitbringen und diese aktiv fördern.“
Digitale Kompetenzen fördern
In der Praxis wird oft übersehen, ob die Mitarbeitenden, die an der Digitalisierung von Abteilungsprozessen beteiligt sind, über die notwendige digitale Affinität verfügen. Das bedeutet, dass die Mitarbeitenden in der Lage sind die richtigen Fragen stellen und das Zusammenspiel verschiedener Schnittstellen in digitalen Prozessen verstehen zu können. Daher sollten Unternehmen bei der Digitalisierung im Blick haben, dass Mitarbeitende diese Kompetenzen mitbringen und diese aktiv fördern.
Die Führungskräfte spielen dabei eine Schlüsselrolle, indem sie die richtigen Freiräume und Tools zur Verfügung stellen, um die digitale Transformation im Unternehmen zu unterstützen. Wie diese Förderung gelingt, zeigt sich z.B. beim Thema Künstliche Intelligenz: Die LEVACO fördert ihre Mitarbeitenden aktiv, sich mit KI-Tools auseinanderzusetzen und herauszufinden, wie diese gewinnbringend im Alltag eingebracht werden können. Ganz pragmatisch wurde so ein neuer Folienmaster durch den Einsatz von KI-gestützten Designtools entwickelt.
Freiräume für Mitarbeitende schaffen zahlt sich also aus. Als innovativer Mittelstand legt die LEVACO besonderen Wert darauf, Vorreiter zu sein und fördert so den Pioniergeist der Mitarbeitenden.
“ Die LEVACO ist sich bewusst, dass nur durch erfolgreiches Change Management die Transformation gelingen kann und setzt daher auf Weiterbildung und das Schaffen von kreativen Freiräumen, um dem zentralen Element – der menschlichen Komponente – gerecht zu werden.“
Change Management und Chancen
LEVACO Chemicals geht über die allgemeinen Herausforderungen der digitalen Transformation hinaus und analysiert spezifische Aspekte, die oft übersehen werden. Die Komplexität von Digitalisierungsprojekten, die oft zu Verzögerungen und unzureichenden Ergebnissen führt, wird detailliert betrachtet. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem notwendigen Umdenken in Projekten und Prozessen, um den Anforderungen der digitalen Transformation gerecht zu werden. Die LEVACO ist sich bewusst, dass nur durch erfolgreiches Change Management die Transformation gelingen kann und setzt daher auf Weiterbildung und das Schaffen von kreativen Freiräumen, um dem zentralen Element – der menschlichen Komponente – gerecht zu werden. Die mangelnde digitale Kompetenz wird als ein Engpass identifiziert, der nicht nur zu ineffizienten Prozessen, sondern auch zu Missverständnissen und letztendlich wirtschaftlichen Schäden führen kann. Das Unternehmen unterstreicht die Notwendigkeit, Mitarbeitende in den Transformationsprozess einzubeziehen, ihre digitalen Kompetenzen zu fördern und so eine Win-Win-Situation zu schaffen.
Ausblick
Der Weg zur erfolgreichen digitalen Transformation ist komplex. Ein ganzheitlicher Ansatz, der Technologie und Mensch gleichermaßen berücksichtigt, ist jedoch erfolgversprechend.
Trotz der vielversprechenden Effizienzgewinne sieht sich gerade auch der Mittelstand in den wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gezwungen, Investitionen in die digitale Transformation einmal mehr begründen und priorisieren zu müssen. Die LEVACO sieht jedoch in der Transformation auch ein Vehikel, die angestrebten Wachstumsziele durch Digitalisierung und Automatisierung zu unterstützen und somit auch die Wirtschaftlichkeit am Standort Deutschland zu sichern. Der richtige Digitalisierungsgrad muss für jedes Unternehmen individuell betrachtet werden – es gibt kein allgemeingültiges richtig oder falsch. Die LEVACO sieht einen besonderen Mehrwehrt darin, durch Digitalisierung Transparenz zu schaffen und die Mitarbeitenden zu befähigen, durch digitale Tools im besten Sinne des Unternehmens handeln zu können. Durch den Wegfall einfacher, nicht-wertschöpfender können die Ressourcen entsprechend neu verteilt werden. Wenn so Freiräume für Innovation und kreative Arbeit entstehen und diese Ressourcen für das Kerngeschäft – die Entwicklung und den Vertrieb von Prozesschemikalien – noch konzentrierter eingesetzt werden können, ist das ein großer Mehrwehrt. Diejenigen, die die digitale Transformation als einen umfassenden Wandel im Denken und Handeln verstehen, werden die Zukunft der Unternehmen bestimmen.
Über die Autoren
Nina Herten |
Jens Becker |
 |
 |
| Nina Herten, Projektmanagerin und Assistenz in der Geschäftsleitung, setzt bereichsübergreifend Projekte zur digitalen Transformation um. | Jens Becker ist Chief Financial Officer bei LEVACO Chemicals. Im Unternehmen verantwortet er das finanzielle Risikomanagement sowie die gesamte Finanzierung und Finanzplanung. Aber auch die Themen Arbeitgebermarke/HR, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Einkauf und Compliance liegen ihm am Herzen. |
Weiterführende Informationen:
https://www.levaco.com/
Aufmacherbild / Quelle / Lizenz
Image by Amrulqays Maarof from Pixabay
Klartext im Job verhindert 77 Prozent der Fehler
/in Allgemein, New Work, Trend Monitor/von Martina Bartlett-MattisEinfachheit macht Unternehmen profitabler und schützt vor Krisen
E-Mail-Flut schluckt fast 30 Prozent der Zeit
Studien zeigen: Produktivität und Effizienz hängen stark von der Qualität der Kommunikation ab. Die Dezentralisierung von Arbeit – Home Office – verstärkt diesen Effekt noch. Denn Mitarbeiter sind noch stärker abhängig von zugänglichen Informationen. Allein die interne Recherche nach Informationen frisst laut McKinsey 20 Prozent der Arbeitszeit – mit E-Mails verbringen Mitarbeiter durchschnittlich 28 Prozent ihrer Zeit.1 Viel davon lässt sich durch effektive Kommunikation einsparen.
77 Prozent weniger Fehler durch verständliche Handbücher
Klare und verständliche Sprache hilft, Missverständnisse zu vermeiden und die Effizienz zu steigern. In einer Studie eines kanadischen Finanzdienstleisters verhinderte klare Sprache 77 Prozent der Fehler.2
„Die Bedeutung einer klaren, verständlichen Kommunikation kann nicht hoch genug eingeschätzt werden“, betont Gidon Wagner, Gründer von WORTLIGA. „Besonders im Home Office, wo der persönliche Kontakt fehlt, ist es umso wichtiger, dass Mitarbeiter jede Nachricht, jedes Dokument und jede Anleitung richtig verstehen. So vermeiden Unternehmen Missverständnisse und Rückfragen. Klare interne Kommunikation fördert nicht nur das Wohlbefinden und die Zufriedenheit, sondern erhöht die Loyalität und das Engagement.“ 3
Millionen einsparen durch weniger verschwendete Lesezeit
Eine Studie im Journal „Business Horizons“ fand heraus, dass eine in einfacher Sprache umgeschriebene Mitteilung beim US-Militär 17-23 Prozent weniger Lesezeit erforderte. Basierend auf diesen Daten schätzten die Autoren, dass die US-Navy jährlich zwischen 27 und 73 Millionen US-Dollar (in 1991er Dollar) an verschwendeter Lesezeit einsparen könnte, wenn nur ihre Offiziere den einfachen Stil verwenden würden.4
Komplexität gefährdet Qualität, Sicherheit und Produktivität
„Niemand kann leugnen, dass unsere Welt immer komplexer wird. Systematische Vereinfachung ist das Gebot der Stunde“, sagt Gidon Wagner. Der TÜV Rheinland bemängelt6, dass Dokumentationen in Unternehmen oft nur von Experten verstanden werden. Der TÜV empfiehlt deswegen das KI-Tool „Plain“ für verständliche Sprache von WORTLIGA. Es soll den Prozess der Vereinfachung unterstützen. Auch alltägliche Texte und E-Mails lassen sich damit in kurzer Zeit verständlicher schreiben – Absender und Empfänger sparen dadurch Zeit.
Ingenieure und Manager lesen lieber Klartext
Probleme durch komplizierte Sprache bei der dezentralen Arbeit treten besonders in Teams auf, die aus verschiedenen Fachbereichen bestehen. Aber auch Experten unter sich bevorzugen verständliche Sprache. Eine Studie beim Verband für Chemie-Ingenieure “IChemE” fand heraus, dass Ingenieure technische Berichte in klarer Sprache lieber lesen.5
Die befragten Ingenieure glaubten zuvor, sie müssten passiv und distanziert schreiben, um professionell zu wirken. Im Rahmen der Studie wurde klar, dass das nicht stimmt. Im Gegenteil: Fachjargon und komplexe Formulierungen werden schnell zu Hindernissen in der Zusammenarbeit.
Studienleiter John Kirkman wollte herausfinden, ob ein direkter, aktiver und persönlicher Stil bei Ingenieuren, Managern und Herausgebern im Verband beliebter ist. Dazu legte er ihnen in einem Experiment sechs verschiedene Versionen eines technischen Berichts vor. Eine dieser Versionen war bewusst direkt und klar verfasst. Diese direkte und klare Fassung kam bei den Studien-Teilnehmern am besten an. Sie wurde als angenehmer, verständlicher und einfacher eingestuft, besonders von den älteren Mitgliedern. Die Studie zeigt auch, dass Experten sich fachlich korrekt ausdrücken und gleichzeitig verständlich bleiben können.
Vorurteile bremsen und verhindern mehr Transparenz
Eine Bremse für den Abbau von komplexen Informationen sind oft ausgerechnet die Führungskräfte. Aber auch viele Mitarbeiter haben Vorurteile gegen verständliche Kommunikation. „Eine Mitarbeiterin einer Zentralbank sagte mir in einem Seminar, dass es im Management viele Vorbehalte gegen Vereinfachung gibt“, sagt Wagner. Die betreffende Zentralbank vereinfachte ihren Jahresbericht und kürzte ihn von rund 160 Seiten auf 100 Seiten. Warum bekam die verantwortliche Editorin neben Unterstützung auch viel Gegenwind? Vor allem aus Sorge, die Zentralbank würde nicht mehr professionell genug klingen. Dabei ist es genau andersrum: Umfragen zeigen, dass 84 Prozent der Menschen eher einer Organisation vertrauen, die auf Fachjargon verzichtet.7
Schulungen und Überzeugungsarbeit: „Es liegt viel Arbeit vor uns“
Die Vorurteile reichen von ‚Das ist doch Babysprache‘ und ‚Das haben wir schon immer so gemacht‘ bis zu ‚Das macht unsere Sprache kaputt‘. „Tatsache ist jedoch: Verständliche Sprache ist anregend und fast alle Menschen bevorzugen Klartext gegenüber komplizierter Sprache. Wie effektiv Digitalisierung ist, hängt auch davon ab, wie effektiv die Kommunikation gelingt. Es liegt viel Arbeit vor uns“, sagt Wagner.
Die WORTLIGA ist bekannt für ihr kostenloses Online-Tool zur Textanalyse und ihr KI-Übersetzungstool „Plain“ für verständliche Sprache. Organisationen wie die Gesellschaft für deutsche Sprache e.V., angesiedelt im Deutschen Bundestag, sowie der AOK-Bundesverband und der TÜV Rheinland empfehlen die WORTLIGA-Technologie. Den Analysen der WORTLIGA vertrauen unter anderem große Unternehmen wie die Generali Deutschland AG oder Institutionen wie die Tagesschau.
1 https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy
2 Clarity 51: Journal of the International Movement to Simplify Legal Language (2004)
3 https://www.nature.com/articles/s41599-023-01806-8
4 https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2011/04/19/putting-it-plainly
5 John Kirkman, What is good style for engineering writing?
6 https://www.qm-aktuell.de/neues-ki-tool-macht-schwere-texte-verstaendlich/
7 Simplicity Survey: A Clarion Call for Transparency (2009)
Aufmacherbild Quelle Lizenz
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay