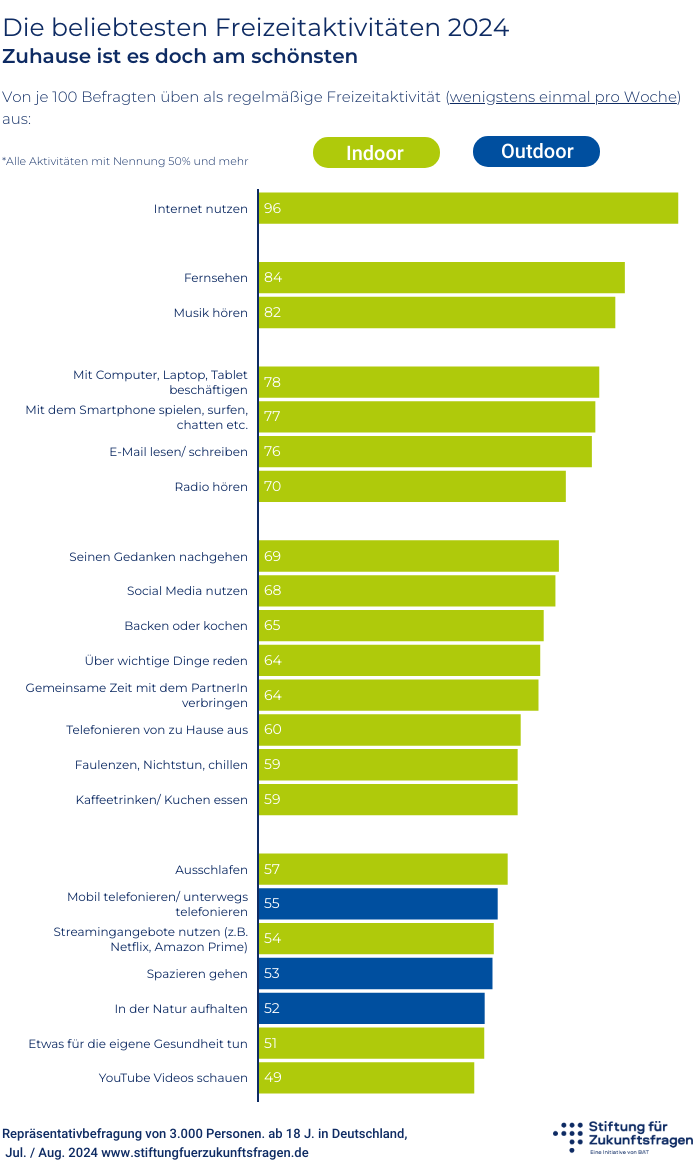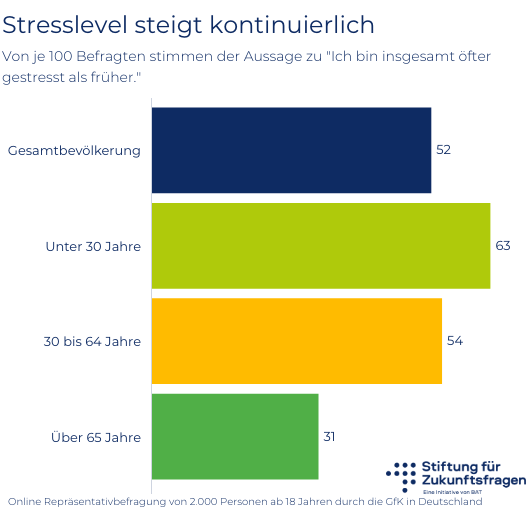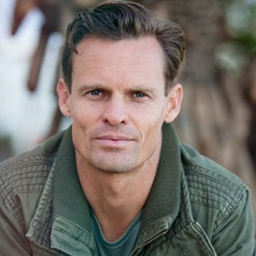Politik schuld am VW-Desaster
Harald Müller, Geschäftsführer der Bonner Wirtschafts-Akademie: „Die Politik der maximalen Unsicherheit trägt eine maßgebliche Mitschuld an der Krise bei VW.“
Vortrag von Harald Müller „Sanierungsfall Deutschland: Wie wir der Deindustrialisierung entgegenwirken können“ bei der Denkfabrik Diplomatic Council am 15. Oktober in Frankfurt: www.diplomatic-council.org/de/bwa2024
Bonn, 9. September 2024 – „Die desaströse Politik der maximalen Unsicherheit in den letzten Jahren trägt ein gerütteltes Maß an Mitschuld am dadurch erzwungenen Sparkurs bei VW“, macht sich Harald Müller, Geschäftsführer Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA), an die Ursachenforschung für die Entlassungswelle und die drohende Werksschließung bei VW. Er sagt: „Die Politik fährt seit vielen Jahren in einem Schlingerkurs einem Ziel entgegen, das sie selbst nicht zu kennen scheint.“
Harald Müller erläutert: „Erst wurde der Diesel als umweltschonend angepriesen, dann wurde er beinahe über Nacht zum Schmutzfinken erklärt. Mit immer schärferen Abgasnormen wurde der Autoindustrie die Elektromobilität aufgedrängt und Verbraucher mit Kaufprämien geködert. Als der Köder funktionierte und die Menschen sich zuhauf E-Autos zulegten, waren die Finanzmittel rasch erschöpft und die Förderung wurde von einem Tag auf den anderen abgeschafft. Das führte zum Kaufstopp bei der Kundschaft, wovon sich die Politik einmal mehr überrascht zeigt und prompt eine erneuerte steuerliche Förderung der E-Mobilität in Aussicht stellt.“ Dieses „unsägliche Hin und Her“ in der Politik habe die Industrie und die Verbraucher gleichermaßen verunsichert.
„Ein Minister kann eine Förderung kurzfristig ins Leben rufen und auch wieder beenden, aber ein Autohersteller braucht auf Jahre hinweg Planungssicherheit, um die entsprechenden Modelle zu entwickeln und in Produktion gehen zu lassen“, zeigt der BWA-Chef die Zusammenhänge auf. Er ergänzt: „Auch auf Verbraucherseite können die wenigsten Menschen mit der Hop-on-hop-off-Politik der Bundesregierung etwas anfangen. Wer sich privat ein Auto zulegt, fährt es im Durchschnitt neun bis zehn Jahre.“
Verbrennerverbot trägt zur Verunsicherung bei
Das drohende Verbrennerverbot trägt nach Einschätzung des BWA-Geschäftsführers zur weiteren Verunsicherung bei: „Bis heute ist völlig offen, ob es in der EU zu einem Verbrennerverbot kommt oder doch nicht. Möglicherweise werden Ausnahmen etwa für E-Fuels zugelassen, eventuell könnte das für 2035 geplante Verbot auch zeitlich nach hinten verschoben werden.“ Einzig das Klimaziel, bis 2040 den CO2-Ausstoß in der EU um 90 Prozent zu reduzieren, scheine festzustehen. „Das wird nicht ohne massive Einschnitte im Verkehrssektor gelingen, zumal im Raum steht, dass es ab 2045 in der EU gar keinen fossilen Sprit mehr geben wird“, sagt Harald Müller, und schlussfolgert: „Der deutschen Automobilbranche steht ein hartes Jahrzehnt mit ungewissem Ausgang bevor. VW ist erst der Anfang.“ Er erwartet noch „weitere Opfer des politischen Schlingerkurses.“
Der BWA-Chef verweist auf die Ankündigung von Mercedes, seine Ausgaben für die Verbrennungsmotortechnologie überplanmäßig bis weit in die 2030er Jahre hinauszustrecken. „Das ist der Versuch, sich aus der industriellen Todeszone zu retten“, analysiert Harald Müller. Er erinnert daran, dass der Konzern mit dem Stern erst 2021 verkündet hatte, dass Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge bis 2025 etwa die Hälfte der jährlichen Verkäufe ausmachen sollten. „Heute ist davon nicht mehr die Rede, aber das Ziel war schon vor drei Jahren völlig unrealistisch“, schüttelt Harald Müller den Kopf ob, wie er sagt, „einem solchen Übermaß an ideologie-getriebener Firmenpolitik.“ Er weist darauf hin, dass der chinesische Automobilbauer Geely erst in diesem Jahr gemeinsam mit Renault den neuen Verbrennerkonzern „Horse Powertrain“ gegründet hat. „Während die deutschen Autohersteller von der wankelmütigen EU-Politik zerrieben werden, springen andere Hersteller in die Lücke“, sagt er.
Neben dem Verlust des technologischen Know-Hows bei Verbrennungsmotoren droht zugleich eine signifikante Reduzierung der Wertschöpfung bei E-Autos, warnt Harald Müller, denn ein Großteil der Wertschöpfung bei der E-Mobilität liegt in der Batterietechnik. Während Deutschland sich gerade bemühe, Batteriewerke ins Land zu holen, bereite die EU eine neue Batterieverordnung mit potenziell verheerenden Konsequenzen für den Produktionsstandort Deutschland vor. Bei der CO2-Bilanz der Batterien soll nämlich ab 2027 der nationale Strommix als Berechnungsgrundlage dienen. „Dabei wird Deutschland aufgrund seines höheren Anteils an Kohle- und Gasstrom im Vergleich etwa zu Ländern mit Atomkraft, die gemäß der EU-Taxonomie als grün gilt, deutlich schlechter abschneiden“, analysiert Harald Müller. Er schlussfolgert: „In diesem Fall stünde die Batterieproduktion in Deutschland vor dem Ende, bevor es überhaupt richtig losgeht. Die damit verbundene Verunsicherung ist heute schon da.“
Bei dem neben der Batterietechnik zweiten maßgeblichen Wertschöpfungspotenzial künftiger Automobile, der Digitaltechnik, stehe Deutschland ohnehin nicht besonders gut dar. „Apple Car Play und Android Auto haben sich längst auf den Weg gemacht, die Intelligenz im Auto zu übernehmen“, meint Harald Müller. Er blickt in die Zukunft: „Bei Künstlicher Intelligenz, dem Herzschrittmacher einer künftigen Generation selbstfahrender Autos, hat sich Europa mit dem EU AI Act eine Selbstbeschränkung auferlegt, die der Automobilbranche in wenigen Jahren einen weiteren Nackenschlag bescheren wird.“
Automobilindustrie ist nicht das einzige Opfer der politischen Planlosigkeit
Die Automobilindustrie ist nach Einschätzung des Chefs der Bonner Wirtschafts-Akademie nicht die einzige Branche, die von der Planungslosigkeit der Politik schwer getroffen ist. So habe beispielsweise die Chemische Industrie schon längst die Reißleine gezogen und mit der Produktionsverlagerung ins Ausland begonnen.
„Die Chemie hat Deutschland unwiederbringlich verloren. Aber bei der Automobilindustrie besteht noch Hoffnung, wenn sich die Politik endlich zu einer langfristigen und an den wirtschaftlichen Realitäten orientierten Strategie durchringen kann. Absehbar ist dies angesichts des aktuellen politischen Gezänks allerdings leider nicht.“
Die BWA Akademie („Consulting, Coaching, Careers“) ist seit über 25 Jahren unter der Geschäftsführung von Harald Müller und Astrid Orthmann als Spezialist für Personalentwicklung, Outplacement, Personalberatung und Training sowie für Arbeitsmarktprogramme wie Beschäftigtentransfer erfolgreich. Die BWA versteht sich als neutraler Vermittler zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zum Vorteil der Arbeitnehmer. Mit Hilfe der BWA haben mehr als zehntausend Arbeitnehmer eine neue berufliche Zukunft gefunden. Das Spektrum reicht von der Begleitung von Change Management-Prozessen über Vermittlung und Coaching von Führungskräften bis hin zur Unterstützung bei der Gründung eines eigenen Unternehmens.
Weitere Informationen: BWA Akademie,
Burgstraße 81, 53177 Bonn, Deutschland,
Tel.: + 49 228 323005-0, E-Mail: info@bwabonn.de,
Internet: www.bwabonn.de