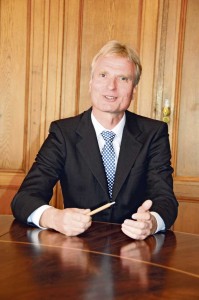Zwei Begriffe stehen in den letzten Jahren im Fokus der Betrachtung – Resilienz, sprich Widerstandsfähigkeit, sowie Nachhaltigkeit, also der sorgsame, zukunftsgerichtete Umgang mit Ressourcen. Nicht erst mit der „Energiewende“ ist bei den Eliten in Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien und auch in der breiten Öffentlichkeit das Bewusstsein gewachsen, dass Nachhaltigkeit immer mehr zu einem Wettbewerbsfaktor in der internationalen Wirtschaft geworden ist. Das hat Konsequenzen insbesondere für ein hochgradig exportabhängiges Land wie Deutschland.
„Die wichtigsten Innovationen sind jene, die das Denken verändern“, so bringt es Professor Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger, deutscher Chemiker, Träger des Bundesverdienstkreuzes und Mitglied der Enquête-Kommission für Gentechnik des Deutschen Bundestages, auf den Punkt. In den letzten Jahren hat sich viel in Europa und in Deutschland verändert – auch das Denken.

Konstantin Strasser: „Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft steht für mich an erster Stelle, was nachhaltige Investitionen angeht.“
Ressourcenschonendes Wirtschaften ist keine Kür mehr, sondern ist Pflicht geworden für Konzerne wie für KMU (kleine und mittelständische Unternehmen). Nicht nur der Gesetzgeber, der mit Gesetzen und Verordnungen wie etwa dem Energiedienstleistungsgesetz reagiert, nimmt Einfluss auf das Geschehen, sondern auch die breite Öffentlichkeit. Schlecht für Unternehmen, die bei Endverbrauchern als rückständig in puncto Nachhaltigkeit verschrien sind. Hier gilt wohl der Spruch: Wer nicht mit der Zeit geht, wird mit der Zeit gehen.
Die Botschaft ist in den Köpfen der meisten Verantwortlichen angekommen, wie Umfragen verschiedener Institute und Unternehmensberatungen belegen: So sagten in einer Roland-Berger-Umfrage 83 Prozent der Befragten, wirtschaftliches Kalkül sei der Haupttreiber für nachhaltiges Wirtschaften. Und sogar 93 Prozent der Befragten gaben in einer Accenture-Studie an, dass Nachhaltigkeit das Kerngeschäft der nächsten Jahre prägen wird. 70 Prozent der Beteiligten bejahten laut Bearing-Point-Untersuchung, dass nachhaltiges Handeln ein ökonomischer Faktor sei. Und immerhin 61 Prozent der Befragten zeigten sich laut KPMG-Umfrage überzeugt, dass sich Nachhaltigkeit auszahle. So spricht man bei Desso, dem nach eigenen Angaben führenden Hersteller von Teppichböden, Teppichfliesen und Sportplatzbelägen, am liebsten vom „Cradle-to-Cradle“-Konzept. Das englische Wort Cradle bedeutet Wiege, frei übersetzt hieße das Konzept also „von der Wiege bis zur Wiege“ und beschreibt den Lebenszyklus und Kreislauf eines Produkts.
Von der Wiege zur Wiege
Dessos Cradle-Konzept wurde zum zweiten Mal in Folge für die britische BusinessGreen nominiert, die jährlich Preise für Unternehmen, Führungskräfte, Investoren und Aktivisten auslobt, welche nachhaltige Geschäftsmodelle und Technologien entwickelt und umgesetzt haben. In Kooperation mit einem niederländischen Wasserversorgungsunternehmen hat Desso eine nachhaltigere und umweltschonendere Alternative zum Kauf des Stabilisators Kalziumkarbonat (Kreide) entwickelt. Roland Jonkoff, Managing Director von Desso, erläutert die Nachhaltigkeit des Verfahrens: „Wir haben einen Weg gefunden, die bei der Enthärtung von Wasser anfallenden Reste von Kalziumkarbonat so aufzubereiten, dass es sich in den Produktionsprozessen von Desso verwenden lässt.“ Desso ist das erste Teppichunternehmen weltweit, das im Upcycle-Verfahren aufbereitetes Kalziumkarbonat einsetzt und voraussichtlich mehr als die Hälfte seines Gesamtbedarfs, genauer gesagt 10 000 bis 12 000 Tonnen, auf diesem Wege erhalten wird. Für Jonkhof beweist das Verfahren „die Stärke von branchenübergreifenden Kooperationen und Innovationen als Wegbereiter für bessere und nachhaltigere Lieferketten und Produkte.“ Die Finalisten des BusinessGreen-Awards werden im Juli dieses Jahres bekannt gegeben.
Kreislaufwirtschaft voll im Trend
Auf „Recycling“ setzt man auch bei der Münchner MEP Werke GmbH. „Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft steht für mich an erster Stelle, was nachhaltige Investitionen angeht“, betont Unternehmensgründer und Geschäftsführer Konstantin Strasser. Er plädiert für kundenwunschorientierte, wieder verwertbare, kombinierbare und modulare Produkte. Als „Full-Service-Anbieter von Solaranlagen“, der sich „Solaranlagen für jedermann“ auf die Fahnen geschrieben hat, sieht sich das Unternehmen dem Aspekt der Nachhaltigkeit besonders verpflichtet.
Um auch ein weniger zahlungskräftiges Publikum zu gewinnen, bieten die MEP-Werke ein Modell an, bei dem Solaranlagen gemietet, statt gekauft werden. „Auf Produktebene werden unsere Solaranlagen so konzipiert und gebaut, dass alle Komponenten ein Höchstmaß an Langlebigkeit erreichen und weitgehend recyclingfähig sind“, so Strasser. Die Herstellung finde in Europa statt, was kürzere Transportwege, strengere Qualitätsregularien und eine regionale Wertschöpfung auch in Form von Arbeitsplätzen mit sich bringe. Ähnlich sehen es Mitbewerber wie die IBC Solar AG. Iris Meyer, Pressereferentin der IBC Solar AG: „Wir sind seit jeher Pionier und Innovationstreiber für Technologien im Photovoltaik-Bereich.“ So hat das Unternehmen 2011 eines der ersten Speicher-Komplettsysteme für Privathaushalte auf den deutschen Markt gebracht. Meyer hebt das Engagement bei der Erforschung von Quartierspeichern hervor, die die Energiewende unterstützen könnten. Zurzeit arbeiten die Spezialisten von IBC Solar mit dem Zentrum für Angewandte Energieforschung (ZAE) Bayern e. V. an der Universität Erlangen-Nürnberg an der Implementierung so genannter „Smart Grids“, „intelligenter“ Stromnetze, im ländlichen Raum.
Trend „Sustainivation“ – Sustainable Innovations
Während es bisher um die Erschließung der Welt ging, dies im Kontext der Nutzung ihrer Ressourcen, werden nun zunehmend die „nachhaltigen“ Innovationen im wörtlichen Sinne, und das bedeutet vor allem das ganze Spektrum der Green Technologies, unsere und die Zukunft der nachfolgenden Generationen grundlegend bestimmen.
- Der umweltbewusste Schiffsantrieb: LNG Hybrid Barge; Becker Marine Systems und AIDA Cruises haben gemeinsam mit weiteren Partnern ein zukunftsweisendes Projekt für eine energieschonende und emissionsreduzierendere Stromversorgung von Kreuzfahrtschiffen während der Liegezeit im Hamburger Hafen entwickelt. www.lng-hybrid.com
- Die Joule Unlimited Inc. macht aus Blaualgen Benzin und Diesel. In der Wüste des US-Bundesstaates New Mexico wurde eine Pilotanlage in Betrieb genommen, die Dieseltreibstoff und Ethanol für Autos mit Verbrennungsmotor liefert. www.jouleunlimited.com
- Der Airbus E-Fan ist ein zweisitziges Elektroflugzeug der Airbus Group Innovations und wird von der Firma Aéro Composites Saintonge in Royan (Département Charente-Maritime, Frankreich) gebaut.
Quelle: Wikipedia