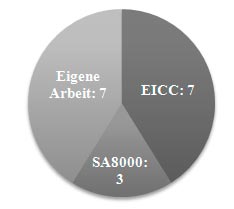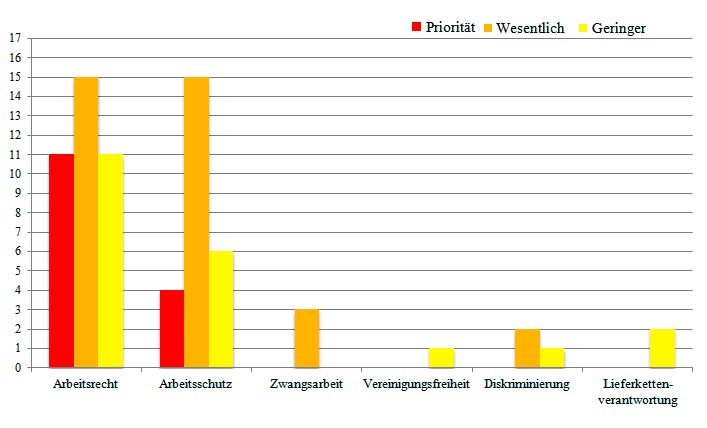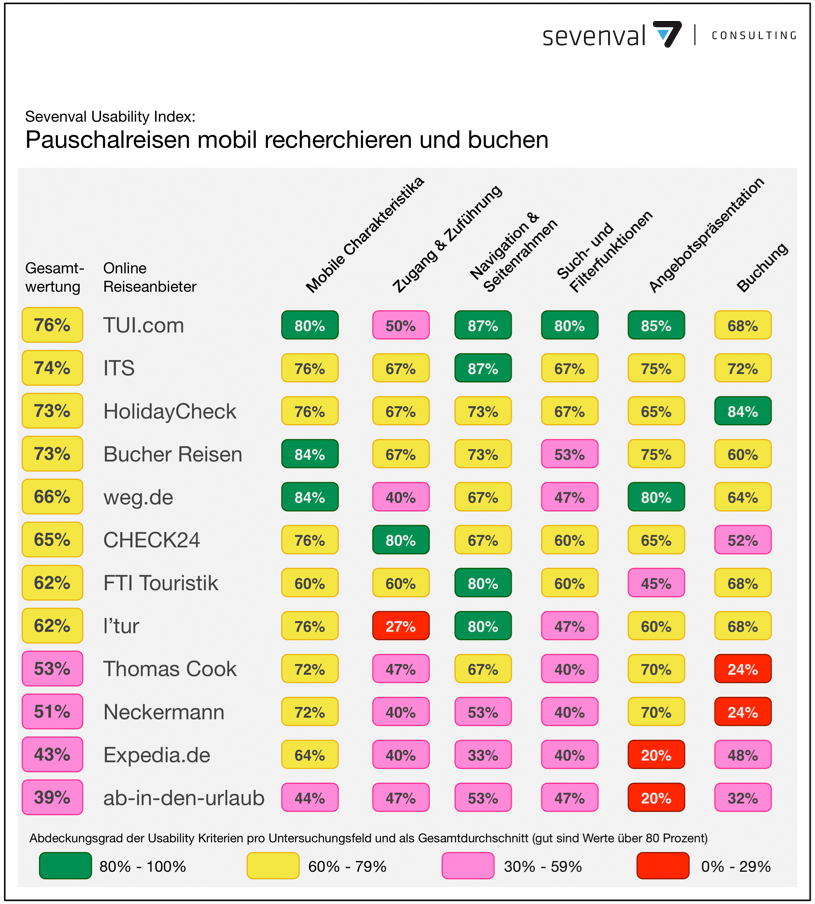Andreas Duthel, Director Lexmark Global Services DACH bei der Lexmark Deutschland GmbH
Gastbeitrag von Andreas Duthel, Director Lexmark Global Services DACH bei der Lexmark Deutschland GmbH
Technologische Weiterentwicklungen beeinflussen stets die Art und Weise, in der Unternehmen geführt werden. Derzeitige wichtige Phänomene, die die Business-Welt unübersehbar prägen und zu einer zunehmenden Vernetzung vieler Bereiche führen, sind Cloud Computing, die sozialen Netzwerke, Big Data und Mobilität. Zusammen genommen bilden diese vier Bereiche die Grundbausteine dessen, was IDC als „die dritte Plattform“ bezeichnet und als neues Fundament für Innovation und Wachstum im IKT-Markt postuliert. In der Ära der Digitalisierung, die von Initiativen wie Industrie 4.0 geprägt ist, betreffen diese Auswirkungen die gesamte Business-Welt, quer über alle Branchen. Seit einiger Zeit ist eine rapide und umfassende Entwicklung im Gange, die diverse unterschiedliche Themenwelten miteinander vereint. Darunter fallen beispielsweise Mobile Computing in Verbindung mit dem mobilen Arbeitsplatz, Cloud Computing und die Möglichkeit mit Hilfe von Big Data-Analysen Informationen zu erhalten die Entscheidern bis dato nicht zugängig waren, das Internet der Dinge, das die Automation und die Produktionssteuerung revolutionieren wird sowie die sozialen Medien, mit denen sich Anwender sowohl unternehmensintern als auch mit Partnern und Kunden vernetzen. Mit der zunehmenden Etablierung dieser Technologien in Unternehmen geht der Trend einher, dass Arbeits-, Freigabe- und andere traditionell papierbasierte Prozesse mit Hilfe moderner Technologien von Spezialisten wie Lexmark zunehmend digitalisiert und automatisiert werden. Dadurch fügen sich die Anwendungsbereiche dieser Prozesse automatisch immer mehr in die vernetzte, nahtlose Geschäftsumgebung ein. Da aber einige dieser Anwendungsbereiche bislang traditionell getrennt waren, muss im Unternehmen zunächst ein Umdenken im Hinblick auf eine ganzheitliche Herangehensweise stattfinden. Unternehmen finden sich vor diesem Hintergrund in einem Spannungsfeld zwischen völlig neuen Möglichkeiten aber auch großen Herausforderungen bei der Umsetzung dieser neuen Ansätze wieder.
Cloud
Unternehmen nutzen cloudbasierte Dienste mittlerweile für eine Vielzahl von Anwendungen. Demzufolge sind auch Geschäftsprozesse, Content Management und Document Imaging zunehmend cloudbasiert. Auf der einen Seite ermöglicht die Cloud Anwendern Skalierbarkeit und Zugriff rund um die Uhr. Auf der anderen Seite zeigen Marktzahlen und Studien, dass deutsche Unternehmen im Umgang mit der Cloud aufgrund der damit verbundenen Sicherheitsbedenken bzw. Compliance-Richtlinien noch immer vergleichsweise zögerlich agieren. Es gilt, die Cloud-Umgebung entsprechend abzustimmen sowie Entscheidungen darüber zu fällen, welche Prozesse und Inhalte lokal verbleiben, und welche in der Cloud realisiert werden. Nicht zuletzt ist die Politik in dieser Hinsicht aufgefordert verbindliche rechtliche Rahmenbedingungen für die Anbieter und Anwender von Cloud basierenden Technolgien zu schaffen um die Datensicherheit zu gewähleisten.

Soziale Medien
Die neuen Social Media-Möglichkeiten haben nicht nur die Art und Weise, wie wir in unserem Privatleben kommunizieren, massiv beeinflusst und verändert, sondern wirken sich natürlich auch auf die Kommunikation im Unternehmen aus, etwa wie sich Kollegen untereinander austauschen. Als natürliche Konsequenz integrieren immer mehr Unternehmensanwendungen mittlerweile auch Social Media-Funktionalitäten. Intern ermöglichen soziale Plattformen den Mitarbeitern, mit Kollegen in Echtzeit zu kommunizieren und Inhalte zu teilen sowie generell eine transparentere Kommunikation. Als Tool, das eine innovative Verbindung von Arbeitsabläufen ermöglicht, kann der Einsatz von Social Media im Unternehmen die Effektivität einiger bisher traditionell getrennter Anwendungsbereiche unterstützen und dient besonders in großen Unternehmen auch als Knotenpunkt für Ressourcen und als Suchplattform. Dieses „Social Everything“-Phänomen bringt natürlich auch Herausforderungen in Sachen Integration für die Unternehmens-IT mit sich.
Analyse
Beim Thema Big Data liegt der Nutzen einer ganzheitlichen Herangehensweise darin, dass trotz eines massiv ansteigenden Volumens an Daten im Unternehmen Content aus verschiedenen Systemen (und in unterschiedlichen Formaten) schnell und unkompliziert zur Verfügung gestellt werden kann. Dazu müssen entsprechende Systeme Massen von unstrukturierten Daten verarbeiten, einschließlich E-Mail- und Dokumenten-Anhängen, Bildscans, Audio- und Videodateien sowie Daten-Feeds aus externen Systemen.
Traditionell wurden Informationen bisher meist in voneinander getrennten, inselhaften Anwendungen und Geschäftsbereichen – sogenannten Datensilos – gespeichert. In der neuen Big Data-Welt liegt der Fokus in Zukunft aber vor allem darauf, diese Trennungen aufzuheben und so systemübergreifende, ganzheitliche Analysen möglich zu machen. Auf diese Weise wird auch die Identifikation von Engpässen zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen erleichtert und Unternehmen erhalten im Idealfall mehr Transparenz darüber, welchen Einfluss die Prozesse des einen Bereichs auf einen anderen haben. Die wissenschaftliche Auswertung der zahlreichen Daten, die unsere bei unseren Kunden installierte Hardware liefern, ermöglicht es der Lexmark Service Organisation, künftig auch die Dienstleistung Preventive Maintenance anbieten zu können. Dabei werden die durch in der Hardware verbauten Sensoren gemeldeten Zustände, wie bspw. die Temperatur eines Gerätes, über eine Flotte von gleichen Modellen systematisch ausgewertet und miteinander verglichen um beispielsweise einen vorsorglichen Wartungseinsatz an einem Gerät vorzunehemen, bevor es zu einem tatsächlichen Ausfall kommt. Auf diese Weise wird die Uptime der Flotte weiter erhöht und Anwender können störungsfrei arbeiten. Echtzeitberichte und -analysen eignen sich dabei optimal als Tools zur ganzheitlichen Erfassung bzw. Darstellung.

Mobile
Der Paradigmenwechsel hin zu einer mobilen Arbeitsweise und „Bring Your Own Device“-Konzepten wurde durch die Entwicklung immer neuer, leistungsstarker Mobilgeräte wie Tablets und Smartphones vorangetrieben. Dieses starke Anwachsen des mobilen Arbeitens bringt auf der anderen Seite natürlich auch eine Zunahme der Komplexität mit sich, denn Inhalte und Anwendungen sind heute über verschiedenste Geräte und Betriebssysteme verteilt und die Gewährleistung der Sicherheit vertraulicher Daten stellt eine grosse Herausforderung dar.
„Mobile Printing“ erweist sich für viele Unternehmen ebenfalls als Herausforderung, auch wenn die zunehmende Nutzung mobiler Geräte das Volumen an Personal Printing zugleich verringert. Dies liegt zum Teil an der kleinteiligen und abgeschlossenen Beschaffenheit vieler mobiler Plattformen.. Lassen sich verschiedene, ehemals inselhafte Anwendungsbereiche aus einer einzelnen, integrierten Perspektive verwalten, fallen viele dieser Hürden jedoch weg, denn: Das Unternehmen kann seinen Content und dessen Management ganzheitlich betrachten. Damit spielt es auch keine Rolle mehr, auf welchem Gerät Inhalte angezeigt oder wie sie erfasst, verarbeitet und ausgegeben werden.
Fazit
Bei flüchtiger Betrachtungsweise mag die oben beschriebene Verschmelzung von Prozessen durch die aktuellen Technologietrends – mit einer in der Folge zunehmenden Verschränkung von bisher getrennten Anwendungsbereichen innerhalb eines Unternehmens – vor allem und in erster Linie als schwierige Herausforderung erscheinen und Unternehmen möglicherweise davor zurückschrecken lassen. Aber die Entwicklung lässt sich nicht zurückdrehen – Unternehmen müssen sich auf diese komplexen Wechselwirkungen zwischen Inhalten, Menschen und Richtlinien innerhalb einer Umgebung sowie auf eine immer dichtere Informationsfülle einstellen. Auch der Bereich Bildverarbeitung und Druck bleibt von diesen Veränderungen natürlich nicht unbeeinflusst und entwickelt sich dadurch immer weiter weg von seinem ehemaligen Schwerpunkt, der papierbasierten Druckausgabe. Die Zukunft in diesem Bereich besteht in der Aufgabe, Daten und Informationen direkt mit Geschäftsprozessen zu verbinden. Diese Entwicklung erfordert eine kontinuierliche Bewertung nicht nur des Managements des Bildverarbeitungs- und Druck-Bereichs, sondern auch des Geschäftsprozess-Ökosystems, das es unterstützt. In einem solchen Szenario erweitern sich die Funktionen des physikalischen Ausgabegeräts von einer klassischen Druckausgabebestelle hin zu modernen, komplexen Tools für Geschäftsprozesse, die papierbasierte und digitale Daten, Dokumente und Inhalte gleichermaßen umfassen und beherrschen. Unternehmen, die aus den neuen Möglichkeiten dieser „dritten Plattform“ einen nachhaltigen Business-Erfolg ziehen wollen, sollten daher alles daran setzen, ihre Dokumentenverarbeitung entsprechend clever in diese Plattform einzubinden.
www.lexmark.de
Kurzinterview mit Andreas Duthel

Andreas Duthel, Director Lexmark Global Services DACH bei der Lexmark Deutschland GmbH
Herr Duthel, in Ihrem Beitrag sprechen Sie die Technologien der sogenannten „dritten Plattform“ an und empfehlen, dass diese mit dem Bereich der Dokumentenverarbeitung verbunden werden sollen. Können Sie uns bitte exemplarisch kurz erläutern, wie sich z.B. die Themen Cloud und Drucken clever miteinander vernetzen lassen?
Natürlich, gerne. Um es mal etwas verkürzt zu formulieren: Die Technologie der Cloud hat dem Thema mobiles Drucken einen enormen Schub beschert: Dokumente können in der Cloud bequem gelagert und quasi jederzeit und von überall aus ausgedruckt werden – es genügt, wenn sich Smartphone und Drucker im gleichen WLAN befinden. Druckfreigabe und Dokumentenverwaltung in der Cloud sowie mobiles Drucken müssen allerdings ebenso sicher sein wie Druckaufträge, die vom Rechner am Arbeitsplatz aus initiiert werden. Wer mögliche Sicherheitslücken zwischen mobilen Geräten und Druckern verlässlich schließen möchte, muss also über entsprechende Sicherheitslösungen nachdenken und sollte letztlich auch die Mitarbeiter über die Risiken mobiler Ausdrucke und den guten Umgang mit vertraulichen Dokumenten aufklären.
Lexmark kann ja auf eine Vielzahl an langjährigen Kundenbeziehungen verweisen und bekommt daher sicher mit, wie weit die Unternehmen im Hinblick auf die „dritte Plattform“ derzeit tatsächlich schon sind. Welche Trends oder Entwicklungen beobachten Sie?
Jeder unserer Kunden hat letztlich natürlich seinen individuellen, ganz eigenen Ansatz in der Umsetzung. Einen gewissen gemeinsamen Nenner in Bezug auf die grundsätzlichen Reaktionen können wir aber feststellen. Die Unternehmen zeigen Aufgeschlossenheit gegenüber den genannten Technologien und Themen, aber man spürt auch einen deutlichen Respekt im Hinblick auf die damit verbundenen Konsequenzen. Von der entsprechenden Umgestaltung des Rechenzentrums, das eine Realisierung all der gewünschten hoch flexiblen, skalierbaren Prozesse in Echtzeit ja erst möglich machen muss, bis hin zu den Konsequenzen für die Mitarbeiter, die entsprechende neue Policies, Schulungen, etc, benötigen, bringt die Umsetzung der „dritten Plattform“ einiges an Aufwand mit sich.
Wenn Sie einem Unternehmen, beispielsweise einem Großunternehmen, eine Empfehlung geben sollten, wie man sich die Vorteile der neuen Trendtechnologien für die Dokumentenverarbeitung zunutze machen kann, was raten Sie?
Die „dritte Plattform“ bietet Unternehmen viele Lösungsmöglichkeiten, mit ihren Daten – insbesondere den unstrukturierten – sinnvoll umzugehen. Gleichzeitig vervielfachen sich – etwa durch die Integration von Social-Media-Kanälen – genau diese Daten bzw. Datensammelplätze aber auch nochmals erheblich. Insofern raten wir unseren Kunden, vor jeder Veränderung oder Erweiterung ihrer Kommunikationsplattformen zunächst ein internes Assessment zu stellen, in dem auch Platz für die Formulierung von Zielvorstellungen und eines Zeitplans sein sollte. Bei der Umsetzung der eigentlichen technologischen Neuerungen und der damit verbundenen Fragen z.B. zur Sicherheit können Technologiepartner, wie wir es sind, schlüsselfertige Antworten liefern. Unternehmen, die von derartigen Neuerungen langfristig und sinnvoll profitieren wollen, sollten jedoch Sorge dafür tragen, dass die neuen Tools auch einen entsprechenden Platz in der Unternehmenskultur erhalten und von den Mitarbeitern angenommen werden.