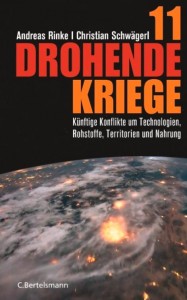Keynote Silvia Ziolkowski
„KMU brauchen eine Vision mit Mitmachpotential“
Hamburg/Stuttgart, 25. Februar 2015. Viele kleine und mittelständische Unternehmen trifft der Fachkräftemangel in MINT-Berufen doppelt hart: Sie müssen für die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber nicht nur mit den oftmals viel bekannteren Marken der Konzerne konkurrieren, sondern gleichzeitig auch die Beschleunigung der globalen Wirtschaft bewältigen. Wie KMU in diesem Wettbewerb bestehen können, erläutert die erfahrende IT-Unternehmerin, Zukunftsentwicklerin und Coach Silvia Ziolkowski in einem Keynote-Vortrag auf den Messen PERSONAL2015 Nord und Süd.
„Die Marktsituation im MINT-Umfeld ist schwierig“, räumt Silvia Ziolkowski ein. Junge Menschen drängten ins Ausland oder in die großen Metropolen. Da schneide ein Mittelständler in der Provinz als potenzieller Arbeitgeber eher schlecht ab. Die meisten KMU müssten aktuell zudem darum kämpfen, das Tagesgeschäft zu bewältigen. „In der ‚Zuvielisation‘, in der wir leben, werden Mitarbeiter von der E-Mail-Flut überrollt und dann kommt noch die Globalisierung hinzu“, so die Keynote-Sprecherin der Messen PERSONAL2015 Nord und Süd. Gleichwohl gebe es oft noch unausgeschöpfte Potentiale, die der Mittelstand verschlafe.
Betriebliche Ausbildung versus War for Talents
Angesichts des Fachkräftemangels in MINT-Berufen plädiert Ziolkowski, die schon mit 26 Jahren selbst ein IT-Unternehmen im Umfeld der Automobil-Industrie mit aufgebaut hat, für mehr Mut zur Ausbildung im eigenen Betrieb. „Das halte ich für den Königsweg schlechthin, insbesondere wenn ein Unternehmen an einem wenig attraktiven Ort ansässig ist.“ Oftmals hemme die Betriebe das Argument, dass sie Mitarbeiter abstellen müssten, um Auszubildende zu betreuen. „Aber das ist ein Denkfehler. Schließlich müssen Sie jemanden, der bereits eine fertige Ausbildung mitbringt, ebenfalls einlernen, wenn er das Geschäft verstehen und sich wohlfühlen soll.“
Unternehmerpersönlichkeit nach außen zeigen
Employer Branding sei ebenfalls ein hilfreiches Werkzeug, greife aber zu kurz, wenn Betriebe es als reines Marketingtool begriffen. „KMU punkten durch ihre Individualität, im Idealfall durch die Unternehmerpersönlichkeit“, so Unternehmer-Coach Ziolkowski. Gerade Mittelständler hätten oft eine personifizierte Marke. Da könne man sich einiges von Familienunternehmen und Gründern wie Anton Kathrein, der die Parabol-Satellitenschüsseln erfunden hat, oder einer Familie Leibinger von der Trumpf Gruppe abschauen. „Um aus der Masse der Kleinunternehmen herauszustechen, muss man sich schon zeigen“, ist die Senatorin der deutschen Wirtschaft überzeugt.
Mit Partizipation glänzen
Der Mittelstand sei zudem beim Thema Partizipation eindeutig im Vorteil. „Wenn ich als junger Mensch ein Unternehmen suche, in dem ich selbstbestimmt arbeiten und mich einbringen kann, dann ist das in einem kleinen oder mittelständischen Betrieb sehr viel leichter möglich als in einem Konzern“, betont Ziolkowski. In Großunternehmen gebe es immer unumstößliche Regeln, die oft vom Shareholder-Value diktiert würden und an die man sich zu halten habe, um erfolgreich zu sein. „Insbesondere bei kleinen und jungen Unternehmen ist hingegen Augenhöhe selbstverständlich.“
Unternehmensvision sollte Emotionen auslösen
Unternehmen könnten bei qualifizierten Bewerbern vor allem mit ihrer Werteorientierung punkten, die sie nach außen tragen und nach innen leben. Dafür brauche es jedoch eine klare Vorstellung davon, wie die Unternehmensvision aussehe. „Es geht dabei um das große Bild der gelungenen Zukunft oder den Traum des Unternehmers“, erklärt die Unternehmensberaterin und nennt ein Beispiel: Ein klassisches mittelständischen Unternehmen aus ihrem Kundenkreis, das Treppenlifte produziere, habe die Vision, Menschen im Alter beweglich zu machen und ihnen Flexibilität zu schenken. „Die Unternehmensvision sollte immer Emotionen auslösen, nur dann hat sie Mitmachpotential.“ Denn das Ziel dabei sei, dass viele Menschen Lust bekämen, sich für diese Vision einzusetzen und daran mitzuarbeiten.
Auf den Messen PERSONAL2015 Nord und Süd vertieft Silvia Ziolkowski diese Themen in einem Keynote-Vortrag:
„Zukunft entwickeln: Wie KMU neben Großunternehmen im War for Talents bestehen können“
Donnerstag, 7. Mai 2015, 10 – 10.45 Uhr, Forum 3, Halle A4, Hamburg Messe und Congress
Dienstag, 19. Mai 2015, 10.15 – 11 Uhr, Forum 2, Halle 6, Messe Stuttgart
presented by German Speakers Association (GSA)
Über Silvia Ziolkowski
Silvia Ziolkowski startete ihre Karriere vor mehr als 26 Jahren: Gemeinsam mit zwei Partnern baute sie ein international agierendes IT-Unternehmen auf, das Software-Lösungen für die Datensicherheit in der Automobilindustrie herstellt. Erfahrungen im Management sammelte sie nicht nur als Vorstandsmitglied dieses Softwarehauses, sondern auch als Businesspartnerin eines Industrieunternehmens. Die Kommunikationswissenschaftlerin ist heute Unternehmercoach für IT-Anbieter und Inhaberin des Beratungsunternehmens ArtVia net.consult. Neben ihrer Mitgliedschaft in der German Speakers Association engagiert sie sich ehrenamtlich als Karriere-Mentor an der Bayrischen Akademie für Werbung und Marketing sowie als Senatorin im Senat der Wirtschaft. Ihre Vision: KMU Mut machen, etwas verrückt zu sein und groß zu denken.
Über die PERSONAL2015 Nord und Süd
Die Messe PERSONAL2015 Nord (6. bis 7. Mai, Hamburger Messehallen) ist die führende Veranstaltung für die Personalwirtschaft in Norddeutschland, während die PERSONAL2015 Süd (19. bis 20. Mai, Messe Stuttgart) als Treffpunkt Nummer 1 für Personaler in Süddeutschland bekannt ist. Personalentscheider, Geschäftsführer und Mitarbeiter von Personalabteilungen erhalten einen Überblick über die Trends im Personalmanagement – von Personalsoftware und Online-Recruiting über Weiterbildung und E-Learning bis hin zu Betrieblichem Gesundheitsmanagement. Integriert in den Ausstellungsbereich läuft jeweils an beiden Messetagen ein umfassendes Begleitprogramm aus Vorträgen, Diskussionen und Networking-Formaten. Das komplette Programm veröffentlicht der Veranstalter Anfang Februar 2015 auf den Messewebsites.
Über spring Messe Management GmbH
spring Messe Management veranstaltet Fachmessen für Personalmanagement, Professional Learning, Corporate Health, job and career und den Public Sector. Langjährige Messe-Erfahrung, thematische Expertise und nachhaltige Kundenorientierung machen die spring-Veranstaltungen zu etablierten Branchenplattformen. Die Fachmessen aus dem Hause spring sind Seismographen für neue Produkte, Ideen und Managemententwicklungen. Das Tochterunternehmen der Deutschen Messe AG ist in vier Ländern vertreten: Deutschland, Österreich, Ungarn und Russland.
www.messe.org