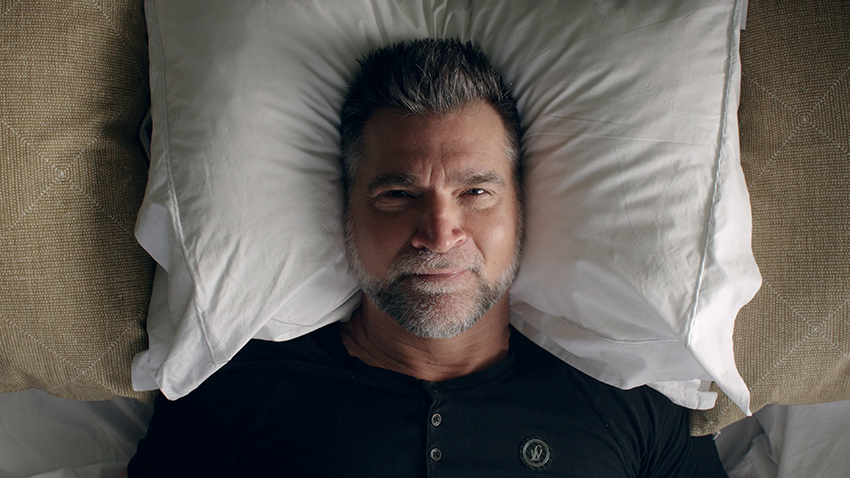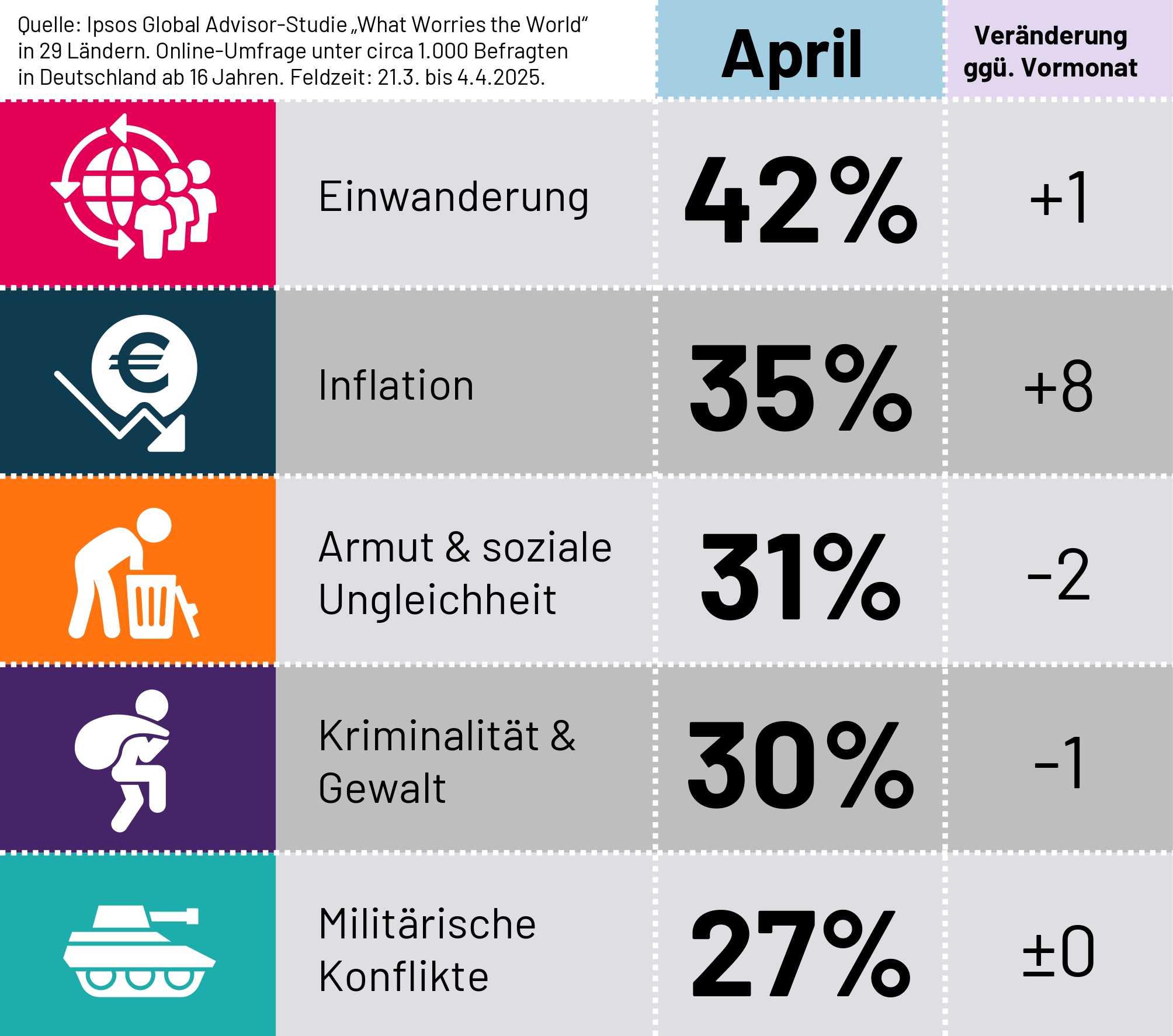Köln, Mai 2025 – Das Kölner Startup dataMatters, eine Ausgründung der RWTH Aachen, hat unter dem Namen urbanOS das nach eigenen Angaben weltweit erste Betriebssystem für Smart Cities vorgestellt. Das kommunale Operating System arbeitet ähnlich wie Computer- oder Smartphone-Betriebssysteme, ist aber für die „Smartisierung“ städtischer Infrastrukturen optimiert, von der Verkehrsführung über die Abfallwirtschaft und die Energieversorgung bis zur öffentlichen Sicherheit. Das „digitale Bürgerhaus“ ist laut Angaben hochskalierbar – es deckt die Anforderungen von Städten, Bezirken und Landkreisen ab, von kleinen Kommunen über Mittelstädte bis hin zu Millionenmetropolen.
Ähnlich wie moderne Smartphone-Betriebssystem wie iOS für das iPhone ist auch urbanOS mit einem AppStore ausgestattet. Kommunale Versorgungsbetriebe und privatwirtschaftliche Unternehmen können ihre Services im urbanOS AppStore anbieten, so dass diese von Leistungsträgern gegen Entgelt in Anspruch genommen werden können.
urbanCockpit erlaubt den Blick in die Zukunft
Das neue kommunale Betriebssystem basiert auf einem Mehr-Schichten-Modell: Sensorik, kommunaler Datenraum, Künstliche Intelligenz (KI), datenbasierte Entscheidungsfindung und optimierte Dienstleistungen für Bürgerschaft und Verwaltung. Dr. Daniel Traut, Firmengründer und Geschäftsführer der dataMatters GmbH, erklärt das Prinzip: „Ein breites Spektrum an Sensoren erfasst, was in der Stadt vor sich geht. Diese Informationen werden in einen kommunalen Datenraum übertragen und dort mittels KI verarbeitet. Die Ergebnisse werden in einem urbanCockpit angezeigt, so dass die Entscheidungsträger erstmals einen minutenaktuellen Überblick erhalten, was in ihrer Stadt tatsächlich vor sich geht, vergleichbar einem Piloten, der ein Flugzeug steuert.“
Der Clou: Die KI blickt sogar in die Zukunft, so dass am urbanCockpit nicht nur die aktuelle, sondern auch die künftige Lage detailliert dargestellt wird. „Das verschafft der Kommune eine nie dagewesene faktische Grundlage für urbane Entscheidungen“, erklärt Dr. Daniel Trauth einen wesentlichen Vorteil des neuen Betriebssystems für Smart Cities. Er gibt ein Beispiel: „Durch Kameras in Bussen und Bahnen lässt sich genau erfassen, wie viele Sitz- und Stehplätze zu welchen Zeiten auf welchen Linien belegt sind. Die KI kann darauf basierend Empfehlungen zur Optimierung des ÖPNV erarbeiten, die auch Ereignisse wie etwa Stadtfeste, Fußballspiele, Kulturveranstaltungen oder verkaufsoffene Sonntage berücksichtigt. Im Ergebnis führt das zu einer höheren ÖPNV-Akzeptanz bei den Bürgern, einem zielgenaueren Personaleinsatz und Reduzierungen bei den Kosten und der Umweltbelastung.“
Erstes Betriebssystem mit Föderierter KI
Nach Recherchen von dataMatters handelt es sich bei urbanOS um das weltweit erste Operating System, in das von Anfang an eine sogenannte Föderierte KI (Federated Learning) integriert ist. Föderiertes Maschinelles Lernen bedeutet, dass ein KI-Modell über zahlreiche Geräte hinweg trainiert wird, ohne dass sensible Daten zentralisiert werden.
Ebenfalls ein Novum: urbanOS setzt neben Federated Learning durchgängig auf sogenanntes Edge Computing. Das bedeutet, dass alle Daten bereits bei der Erfassung von jedwedem Personenbezug bereinigt werden. Beispiel: Kameras, die Fußgänger, Radfahrer und Fahrzeuge zählen, um anhand der Ergebnisse die Verkehrsströme zu optimieren, löschen bereits vor Ort alle Gesichter und Kfz-Kennzeichen. Es werden also keinerlei Informationen an den kommunalen Datenraum übertragen, die direkt oder indirekt Rückschlüsse auf Personen zulassen.
„Entpersonalisierung der Daten am Punkt der Erfassung“ durch die Kombination aus Föderierter KI und Edge Computing nennt dataMatters dieses neue Paradigma des konzeptionell integrierten Datenschutzes. „Die Kommunen wollen eine Smart City, aber keine Überwachungsstadt schaffen“, erklärt dataMatters-Geschäftsführer Dr. Daniel Trauth, „dem Schutz der sensiblen Daten der Bürgerinnen und Bürger kommt daher höchste Priorität zu.“ Somit versteht es sich beinahe von selbst, dass alle Daten durchweg in Rechenzentren verarbeitet werden, die sich in Deutschland befinden und ausschließlich dem deutschen Rechtssystem unterliegen. Eine Übertragung in ausländische Datenclouds findet nicht statt – ein wichtiger Aspekt angesichts des löcherigen Datenschutzes etwa in den USA, wo viele gängige Cloudanbieter ansässig sind. „Die viel geforderte Autarkie bei der Digitalisierung ist bei urbanOS auf kommunaler Ebene rundum gewährleistet“, versichert Dr. Daniel Trauth.
Künstliche Intelligenz aus dem Smart-Kraftwerk
Welche Künstliche Intelligenz im Rahmen von urbanOS zum Einsatz kommt, kann jede Gemeinde bzw. jede Stadt frei entscheiden. „Wir können jedes Large Language Modell anbinden“, zeigt sich Dr. Daniel Trauth flexibel. Ebenso liegt es im Entscheidungsbereich der städtischen Gremien – Gemeinde- bzw. Stadt- oder Landrat resp. (Ober-)Bürgermeister –, ob die KI in einem kommunalen Rechenzentrum betrieben werden soll oder extern über einen Cloudservice bezogen wird. Gleiches gilt für den Datenraum, in dem alle städtischen Informationen zusammenfließen, um zur KI-Auswertung bereitzustehen. „Bei Bedarf liefern wir Datenraum und Künstliche Intelligenz komplett mit“, sagt Dr. Daniel Trauth, „die Kommune bezieht in diesem Fall die gesamte Funktionalität einschließlich KI-Analysen von uns wie aus einem Smart-Kraftwerk.“ Auf Wunsch kann die Gemeinde Datenraum und KI-System aber auch eigenständig betreiben und nur das Betriebssystem von dataMatters für die „Smartisierung“ nutzen.
Nach Angaben von dataMatters unterschützt urbanOS heute schon alle gängigen KI-Modelle und IT-Systeme, so dass diese nahtlos an das kommunale Betriebssysteme angedockt werden können. Technisch handelt es sich dabei um ein „Application Programming Interface“ (API), das alle marktüblichen Schnittstellen umfasst. „Wir unterstützen unzählige Konnektoren zu Sensoren, Funknetzen, Datenbanksystemen sowie Drittanbietersoftware und OpenData-Portalen“, sagt Dr. Daniel Trauth. Er versichert zugleich: „Eventuelle Spezialwünsche einer Kommune oder auch eines Bundeslandes werden im Rahmen eines Smart-City-Projekts von uns gerne erfüllt“.
Für die Funkanbindung der Sensoren setzt dataMatters auf sogenannte „Long Range Wide Area Networks“ (LoRaWAN). Diese ermöglichen die Datenübermittlung über lange Strecken mit minimalem Energieaufwand. Der Funkstandard LoRa wurde speziell für das „Internet der Dinge“ (Internet of Things, IoT) entwickelt, wozu die in Smart Cities eingesetzten Sensoren aller Art gehören. Schätzungen zufolge sind weit über zehn Milliarden IoT-Geräte weltweit im Einsatz.
In konkreten Projekten bereits im Einsatz
Dr. Daniel Trauth legt Wert darauf, „dass urbanOS im Rahmen konkreter Projekte in Zusammenarbeit mit mehreren Städten und Gemeinden entstanden ist und nicht etwa am grünen Tisch entwickelt wurde.“ Er nennt Beispiele: In der Stadt Dormagen, zwischen Köln und Düsseldorf gelegen, sind zahlreiche Straßenlaternen mit Sensorboxen in etwa drei Metern Höhe ausgestattet. Die darin untergebrachten Sensoren messen Umweltwerte wie Luftfeuchtigkeit, CO2-Belastung, Feinstaub und Lautstärke und zählen zugleich die Anzahl der vorbeikommenden Fußgänger, Radfahrer und Autos. Das städtische Sensornetz erlaubt es, Stellen mit starker Verkehrsbelastung herauszufinden, gibt den Einzelhändlern und Gastronomen wertvolle Einblicke in die Kundenströme und hilft Stadtfeste zielgenauer zu planen und auszuwerten. Durch „intelligente“ Parkraumbewirtschaftung lässt sich die Balance zwischen dem Ziel autofreier Zonen einerseits und dem Wunsch des stationären Handels andererseits, Kunden zum Einkaufen in der City zu bewegen, um nicht noch weitere Umsätze an den Online-Handel zu verlieren, herstellen. Zudem lassen sich Stellen mit übermäßiger Hitzebelastung identifizieren, um die Bevölkerung im Sommer durch Verschattungsmaßnahmen vor den Folgen der Erderwärmung zu schützen. Alle Daten fließen im kommunalen Datenzentrum zusammen, das mit urbanOS arbeitet.
Ebenso hat die bei Köln gelegene Stadt Hürth die Abfallentsorgung mittels urbanOS optimiert. Dazu wurden die öffentlichen Abfallbehälter mit Ultraschallsensoren ausgestattet, die den Füllstand messen und ihn mittels Funk an das Smart-City-Betriebssystem übertragen. Dort wird mit Künstlicher Intelligenz ermittelt, welche Route die Müllwagen zum Leeren der Behälter am besten nehmen sollten. Durch die Dynamisierung der zuvor festen Route werden Leerfahrten vermieden, was rund 20 Prozent Kosten einspart und die CO2-Emissionen um etwa 30 Prozent verringert, während gleichzeitig gewährleistet ist, dass die Abfallbehälter nicht überquellen. „Kosten sparen, Umweltbelastung reduzieren und besserer Bürgerservice sind die typischen Merkmale einer Smart City“, sagt Dr. Daniel Trauth.
Im Landkreis Coesfeld im Münsterland, der elf Städte und Gemeinden mit einer Viertelmillion Einwohner umfasst, befinden sich derzeit zahlreiche Anwendungsfälle in der Pilotphase. Dazu gehören: permanente Überprüfung der Wasserqualität von Seen und Flüssen, Luftqualitätsüberwachung (Feinstaub, CO2, Temperatur), Stärkung des Einzelhandels durch stets aktuelle Informationen über Passantenströme, Energie- und Ressourcenüberwachung (Strom, Gas, Wasser), Parkraum-Verwaltung (Steuerung des Verkehrs zu freien Parkplätzen/-häusern), Wildmüll-Vermeidung, automatische Bewässerung von Bäumen und Grünflächen zur Vermeidung von Trockenstress.
Insgesamt befindet sich urbanOS nach Angaben von dataMatters in über 20 Städten in einer frühen Startphase, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Belgien, Frankreich und den Niederlanden. „Die meisten Kommunen wollen verständlicherweise aber erst an die Öffentlichkeit treten, wenn die Projekte deutlich weiter fortgeschritten sind“, sagt Dr. Daniel Trauth. Unter www.urbanos.datamatters.io will dataMatters künftig über den Ausbau des neuen Betriebssystems für Smart Cities informieren. Dort sind auch erste smarte Anwendungen im Stil eines Videospiels anschaulich dargestellt („Smart City Heroes“) mit „Data Dan“ in der Hauptrolle.
Mehr als Vernetzung der Öffentlichen Verwaltung
Dr. Daniel Trauth grenzt urbanOS von der bloßen Computervernetzung in der Öffentlichen Verwaltung ab, wie sie heute schon mit herkömmlichen Betriebssystemen wie Windows oder Linux erfolgt. „Bei der Smartisierung geht es nicht bloß um Verwaltungsvorgänge, sondern um die Verbindung mit der realen Welt, in der die Bürgerinnen und Bürger tagtäglich unterwegs sind.“
Der dataMatters-Chef verweist auf Schätzungen, wonach der Durchschnittsbürger in Deutschland drei- bis zehnmal im Jahr in Kontakt mit einem Amt kommt. „Aber auf der Straße ist er täglich unterwegs, die Müllabfuhr kommt mehrmals pro Woche, die Energieversorgung läuft hoffentlich unterbrechungsfrei“, stellt Dr. Daniel Trauth klar, warum die „Smartisierung“ der Kommunen weit über die Öffentliche Verwaltung hinausreicht.
Konzentration in Ballungsräumen bedingt Smart Cities
Dr. Daniel Trauth verdeutlicht die Dringlichkeit, unsere Städte „smarter“ zu machen, anhand von Zahlen. So leben nach Angaben der Vereinten Nationen seit 2008 erstmals in der Geschichte der Menschheit mehr Menschen in Ballungsräumen als auf dem Land. Laut Schätzungen werden 2030 über 60 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben, bis 2050 sollen es etwa zwei Drittel werden. „Die mit dieser Konzentration verbundenen Herausforderungen sind gewaltig und werden nur durch Smart Cities zu bewältigen sein“, erklärt der Geschäftsführer von dataMatters, warum die Entwicklung eines eigens dafür optimierten urbanen Betriebssystems überfällig war.
Schon heute werden etwa 70 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs in Städten verbraucht, obwohl diese nur fünf Prozent der Landmasse der Erde einnehmen. Damit verbunden ist ein stetig wachsender städtischer Bedarf an Wasser, Land, Baumaterialien, Nahversorgung, Luftreinhaltung und Abfallmanagement. Die Städte stehen unter ständigem Druck, bessere Dienstleistungen anzubieten, die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken, die Effektivität und Produktivität zu erhöhen und der Überlastung der Infrastruktur und der Umweltbelastung entgegenzuwirken. „Diese Herausforderungen können nur mit Smart-City-Konzepten bewältigt werden“, ist Dr. Daniel Trauth überzeugt.
Intelligente Infrastrukturen als Basis
Die zu den Vereinten Nationen gehörende International Telecommunication Union (ITU) hat aus über 100 verschiedenen Definitionen zu Smart City die folgende Festlegung getroffen: „Eine smarte nachhaltige Stadt ist innovativ und nutzt Informations- und Telekommunikationstechnologien und Weiteres, um die Lebensqualität, Effizienz der städtischen Betriebe und Services sowie die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, und dadurch die Anforderungen der heutigen und künftiger Generationen in Bezug auf Wirtschaft, Soziales und Umweltbelastung zu erfüllen.“
„Der Begriff Smart City beschreibt also ein umfassendes Konzept für eine Stadt, in der Daten in Form von smarten – ‚intelligenten‘ – Infrastrukturen eine Schlüsselrolle spielen. Dazu gehören folgende Bereiche: Gebäude, Mobilität, Energie, Wasser, Entsorgung, Gesundheitswesen und digitale Infrastrukturen“, erklärt Dr. Daniel Trauth und ergänzt: „All diese Bereiche werden von urbanOS abgedeckt.“
Smart Cities sind die Zukunft
Dabei wird von fünf ineinandergreifenden digitalen Schichten ausgegangen: Einem weit verteilten Sensornetzwerk, einer Konnektivität zum „Einsammeln“ der Daten, einer Datenanalyse mit Vorhersagefunktionalität, einer Automatisierungsschicht und einem Stadtnetzwerk, das die physische und digitale Infrastruktur verbindet. „urbanOS bietet das digitale Rückgrat für all diese Bereiche“, sagt Dr. Daniel Trauth, „es dient dazu, die immensen Datenmengen aus den völlig unterschiedlichen Gebieten zu erfassen, zusammenzuführen und mittels KI auszuwerten.“
Der weltweite Markt für Smart Cities wird derzeit auf über 700 Milliarden Dollar geschätzt und soll bis 2030 auf eine Größenordnung von 4 Billionen Dollar anwachsen. Der deutsche Smart-Cities-Markt wird derzeit auf rund 8 Milliarden Euro geschätzt und soll bis 2030 auf bis zu 47 Milliarden Euro anwachsen. „Das Potenzial für Smart Cities ist immens und urbanOS kommt genau zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt“, ist Dr. Daniel Trauth überzeugt.
Zukunft: Städte miteinander vernetzen
Perspektivisch geht es darum, nicht nur einzelne Städte smarter zu machen, sondern die Smart Cities auch untereinander zu verbinden. Das neue urbanOS kommt hierzu bereits projektweise im Bundesland Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Förderprojekts „DatenMarktplatz.NRW“ zum Einsatz, das den Aufbau eines regionalen Datenökosystems zum Ziel hat. In den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Hessen ist urbanOS ebenfalls bereits am Start.
Dr. Daniel Trauth skizziert die Zukunft: „Mehrere Städte errichten ihre Datenräume in einer urbanOS-Zentrale, in der mit Zustimmung der Gemeinden die Datenbestände auch übergreifend durch KI ausgewertet werden. So werden Erfahrungen gepoolt und die Städte können voneinander profitieren. Durch die Nutzung der urbanOS-Zentrale können die Kommunen in erheblichem Umfang Kosten sparen, weil sie keine eigenen KI-Infrastrukturen aufbauen müssen, heißt es bei dataMatters. Dr. Daniel Trauth betont: „Dank Federated Learning und Edge Computing ist in allen diesen Fällen der Datenschutz inhärent gewährleistet, weil in der urbanOS-Zentrale überhaupt keine Informationen ankommen, die irgendwelche Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen.“
Wie dataMatters mitteilt, ist urbanOS auch auf die nächste Generation sogenannter Aktoren vorbereitet. Während Sensoren Daten erfassen, handelt es sich bei Aktoren um Geräte, die Aktionen veranlassen, also beispielsweise Ampeln schalten, digitale Anzeigen steuern, Bewässerungssysteme in Betrieb nehmen oder Parkleitsysteme verwalten. Mit der „nächsten Generation“ sind neuartige KI-Roboter gemeint, die in den nächsten Jahren verfügbar werden sollen und in Kommunen beispielsweise als Gärtner, Reinigungskräfte, Assistenten für öffentliche Dienstleistungen oder für Sicherheitsaufgaben eingesetzt werden können. „Was heute noch wie Science Fiction klingt, wird in einigen Jahren zum Alltag gehören“, blickt Dr. Daniel Trauth in die Zukunft. Um diese Entwicklung mit beeinflussen zu können, hat er die Position des Co-Chairman im „Real World AI Forum“ („KI in der realen Welt“) beim globalen Think Tank Diplomatic Council mit UN Consultative Status übernommen. In dieser Rolle gehört er zum engsten Beraterkreis der Vereinten Nationen.
dataMatters (www.datamatters.io) ist auf die Nutzung Künstlicher Intelligenz in der Realwirtschaft spezialisiert. Einsatzgebiete: Smart City, Smart Factory, Industrie 4.0, Smart Buildung, IoT, Maschinen- und Anlagenbau, Gesundheitswesen, Agrarwirtschaft u.v.a.m. Dabei werden über Sensoren Daten aus dem realen Betrieb erfasst, in Datenräumen gesammelt und dort mittels KI-Software analysiert bzw. an KI-Systeme der Firmenkunden zur Weiterverarbeitung übergeben. Anhand der Ergebnisse lässt sich der Betrieb effizienter, nachhaltiger und wirtschaftlicher führen. Anwendungsbeispiele: Parkraumbewirtschaftung, Frühwarnsysteme für Anomalien wie beispielsweise Extremwetter, Maschinenverschleiß oder Rohrbruch, Heizungs-/Beleuchtungsautomatisierung in Gebäuden, CO2-Footprint-Erfassung anhand realer Daten und vieles mehr. So greifen bspw. Kommunen gerne auf urbanOS, das erste für Smart Cities optimierte Betriebssystem von dataMatters zurück, um die urbane Lebensqualität und Nachhaltigkeit zu erhöhen. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Daniel Trauth hat dataMatters aus der RWTH Aachen ausgegründet und zu einem internationalen Player an der Schnittstelle zwischen Realwirtschaft und KI geführt. Er wurde hierfür mit über 20 Ehrungen (RWTH Spin-off Award 2019, digitalPioneer 2020 u.v.a.m.) ausgezeichnet.