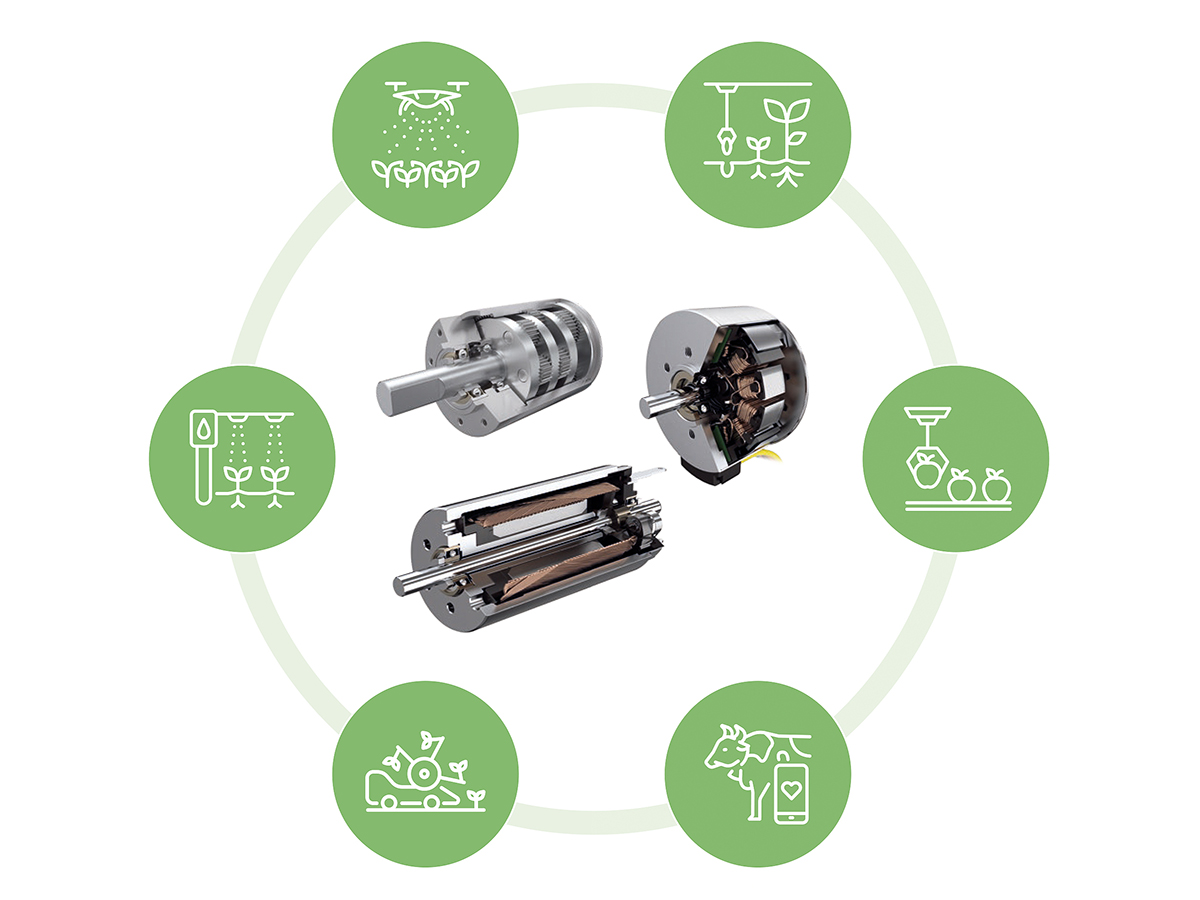Saubere Stammdaten sichern internationale Wettbewerbsfähigkeit
Warum benötigen Unternehmen saubere Stammdaten, um den Anschluss zum internationalen Wettbewerb zu halten?
Die TREND REPORT Redaktion sprach dazu mit Maurice Schnitzler, Principal Master Data Governance, und Christian Falke, Partner SAP Architecture, Development and Integration, beim SAP Gold Partner apsolut.
Weshalb gestaltet sich die Lage für die Unternehmen in Deutschland derzeit so schwierig?
Maurice Schnitzler: Ein zentraler Schmerzpunkt ist sicher der massive internationale Wettbewerbsdruck. Nach einer aktuellen ifo-Umfrage verschlechtert sich die Wettbewerbsposition der deutschen Industrie innerhalb der EU und auf den Weltmärkten seit nunmehr zwei Jahren. Um diesem Abwärtstrend entgegenzuwirken und nicht den Anschluss zu verlieren, müssen die Unternehmen permanent neue Möglichkeiten erschließen, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, den Kundenservice zu verbessern, die Betriebskosten zu senken, attraktive Geschäftsfelder zu erschließen und ihre Effizienz zu steigern.
Hinzu kommt, dass sich die Betriebe mit immer mehr gesetzlichen Vorschriften im Bereich Umwelt, Soziales und verantwortlicher Unternehmensführung konfrontiert sehen. Die Regulierungsdichte nimmt zu. Aktuelle Beispiele sind das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), das zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in den Lieferketten verpflichtet, und die neue Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU, die die Nachhaltigkeitsberichterstattung weiter verschärft. Unternehmen, die die Vorgaben nicht einhalten, müssen mit teilweise empfindlichen Geldbußen und Imageverlusten rechnen, die ihnen den Weg zu Investmentquellen und Geschäftsmöglichkeiten versperren.

Maurice Schnitzler betont: „Saubere Daten sind unverzichtbar, damit Unternehmen den Durchblick gewinnen und die Voraussetzungen für modernes Wachstum schaffen.“
Wie können die Unternehmen den steigenden Anforderungen begegnen?
Christian Falke: Eine entscheidende Voraussetzung sind zuverlässige und eindeutige Stammdaten, da diese die Basis für fundierte strategische Entscheidungen, für Reportings und die Rationalisierung von Geschäftsprozessen bilden. Zudem ist es den Unternehmen mit einem einheitlichen Datenbestand überhaupt erst möglich, den Mehrwert zukunftsweisender KI-Technologien auszuschöpfen.
Intelligente Tools bieten bisher unerreichte Wettbewerbsvorteile. Sie unterstützen wichtige Entscheidungsprozesse, indem sie Datenanalysen und Handlungsempfehlungen bereitstellen. So lässt sich mithilfe von KI aus einer Vielzahl von Anbietern exakt derjenige Lieferant herausfiltern, der die benötigten Fähigkeiten mitbringt. Ebenso ist es mit prädiktiven KI-basierten Analysen möglich, künftige Trends vorauszusagen und proaktive Maßnahmen zu ergreifen. Wer zum Beispiel weiß, wie sich die Nachfrage nach bestimmten Produkten oder Dienstleistungen entwickelt, kann gezielt neue Geschäftsmodelle zur Kundenakquise, -betreuung und -bindung kreieren. Zudem können KI-Tools für die Automatisierung ermüdender Routineaufgaben, wie das Beantworten von Kundenanfragen, eingesetzt werden. Die Mitarbeiter gewinnen dadurch mehr Zeit für kreative Aufgaben und können verstärkt zur Wertschöpfung im Unternehmen beitragen.

Christian Falke betont: „Höchste Zeit zu handeln! Betriebe und Organisationen sind daher gut beraten, schleunigst ein zentrales Stammdatenmanagement (Master Data Management, MDM) zu etablieren. „
Wie ist es aber tatsächlich um den Einsatz von Stammdatenmanagement in der Praxis bestellt?
Maurice Schnitzler: Obwohl der Nutzen verlässlicher Daten über Produkte, Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter, Standorte oder Inventar außer Zweifel steht, hinkt die Praxis dieser Erkenntnis häufig hinterher. Das heißt konkret: In historisch gewachsenen Konzern- und IT-Strukturen verteilen sich die Informationen auf vielen verschiedenen Datenbanken und Geschäftsanwendungen. Oft fehlen Schnittstellen, zugleich wird das Problem der Datensilos angesichts der ständig steigenden Datenflut immer weiter verschärft. Darüber hinaus führen fehlende Verantwortlichkeiten und Richtlinien für die Eingabe und Verwaltung zu einer schlechten Datenqualität, die durch fehlerhafte, unvollständige, doppelt vorhandene oder veraltete Informationen gekennzeichnet ist. Eine Studie des Bitkom-Branchenverbands kommt zum Ergebnis, dass die überwiegende Mehrheit der Unternehmen in Deutschland das Potenzial ihrer Daten derzeit nicht ausschöpft, um von KI-basierten Erkenntnissen oder datengetriebenen Geschäftsmodellen zu profitieren. Ein wesentlicher Grund dürfte das Fehlen einer kohärenten, umfassenden Datenstrategie sein.
Was sollten die Unternehmen tun, um dieses Defizit effektiv aufzuarbeiten?
Christian Falke: Die Betriebe und Organisationen sind gut beraten, schleunigst ein zentrales Stammdatenmanagement (Master Data Management, MDM) zu etablieren. Nur so können sie den Durchblick gewinnen und die Voraussetzungen für ein modernes Wachstum schaffen – und damit ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern. Allerdings ist zu beachten, dass MDM kein rein technisches Thema ist. Es reicht weit über die Zusammenführung und Bereinigung von Daten aus verschiedenen Quellsystemen in einer MDM-Plattform – dem so genannten „Single Point of Truth“ – hinaus.
Da die fachliche Zuständigkeit für die Daten bei den Teams und den Abteilungen liegt, müssen auch diese frühzeitig für die Wichtigkeit des Themas sensibilisiert und zum Beispiel im Rahmen von Workshops in das MDM-Projekt eingebunden werden. Um die Akzeptanz für das neue System zu erhöhen, ist ein gezieltes Change Management unverzichtbar. So müssen im Sinne von Data Governance klare Verantwortlichkeiten und Befugnisse für die Daten festgelegt und die Fachanwenderinnen und -anwender in der Nutzung der neuen Prozesse und Technologien geschult werden. Die Praxis zeigt, dass der Aufbau einer unternehmensweiten Datenkultur und -mentalität ein kritischer Erfolgsfaktor bei jeder MDM-Einführung ist.
Wie kann apsolut die Unternehmen bei ihrem MDM-Projekt unterstützen?
Christian Falke: Mit apsolut haben die Betriebe und Organisationen einen erfahrenen Beratungspartner zur Seite, der umfassendes Fach- und Technologie-Know-how mit langjährigen MDM-Projekterfahrungen kombiniert. Dies reicht von Strategie- und Prozessberatung bis hin zur Implementierung einer MDM-Plattform „State of the Art“. Dabei unterstützen wir die Unternehmen mit einem umfassenden Data-Governance-Konzept, um organisationsweit einheitliche Prozesse, Rollen, Richtlinien und Verantwortlichkeiten zu etablieren. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden legen wir fest, wer welche Daten in welchen Situationen und mit welchen Methoden nutzen kann.
Zugleich schaffen wir mit unseren bewährten Change-Management-Methoden die organisatorischen Voraussetzungen, damit ein Unternehmen seinen Datenschatz, das „Gold des 21. Jahrhunderts“, heben – und damit den Anschluss im internationalen Wettbewerb halten kann.
Maurice Schnitzler: Als SAP Gold Partner und mehrfach ausgezeichneter SAP Ariba Partner of the Year ist das apsolut-Beratungsteam für SAP-Anwenderunternehmen der richtige Ansprechpartner in Sachen MDM. Diese Kunden können wir dank unserer umfassenden SAP-Expertise effizient dabei unterstützen, ihre SAP- und Non-SAP-Stammdaten aus den unterschiedlichsten Datenbanken und Anwendungen zusammenzuführen und zu bereinigen – und damit von einer übergreifenden Datenstrategie zu profitieren.
Prinzipiell sollte erwähnt werden, dass apsolut einen starken Fokus auf die konzeptionelle MDM-Beratung von Kunden legt. Bei Bedarf bieten wir über die reine Strategie- und Prozessberatung hinaus auch Unterstützung bei der technologischen Umsetzung des MDM-Projekts an. Welche MDM-Plattform dafür in Frage kommt, hängt von den kundenindividuellen IT-System- und Prozesslandschaften und den speziellen Anforderungen ab. Da wir auf ein Ökosystem unterschiedlicher Technologien und Lösungen zurückgreifen, können wir jedem Kunden etwas anbieten, das für seine individuellen Bedürfnisse und aktuelle Situation passt. Denn nur auf dieser Grundlage ist es möglich, das Potenzial innovativer KI-Anwendungen als „Treibstoff“ für erfolgskritische Entscheidungen und zukunftsorientierte Geschäftsmodelle zu nutzen.
Über die Interviewpartner:
Maurice Schnitzler ist Principal Master Data Governance bei apsolut. Er verfügt über mehrjährige Erfahrungen im Mittelstand, wo er für einen Baustoffzulieferer und eine Brauerei für die Themen Stammdatenmanagement, Datenqualität, Informationsmodellierung und Change Management zuständig war. Weitere berufliche Stationen liegen in der Finanzbranche. Hier war Maurice Schnitzler für das größte Leasingunternehmen in Deutschland und für einen Versicherer als Data Governance Officer im Bereich Data Governance, Datenstrategie, Metadaten-Management und Schulungen tätig.
Christian Falke ist Partner SAP Architecture, Development and Integration bei apsolut. Er ist seit 16 Jahren als SAP-Berater tätig und für die strategische Planung und Umsetzung von Kundenprojekten, vor allem im Bereich Einkaufsprozesse und Supply Chain Management, zuständig. Ein weiterer Fokus liegt auf Lösungen zur Optimierung von Stammdatenprozessen in SAP. Christian Falke unterstützt die Geschäftsführung bei strategischen Entscheidungen und baut bei apsolut mit seinem Team das Beratungsangebot für das Stammdatenmanagement und die SAP BTP (Business Technology Platform) Services weiter aus.