Der rasant steigende globale Ressourcenverbrauch führt laut Global Footprint Network dazu, dass im Jahr 2022 etwa 1,75 Erden notwendig gewesen wären, um ihn zu decken. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) wollen den bisherigen linearen Wirtschaftsansatz „take, make, use, dispose“ (nehmen, machen, benutzen, entsorgen) grundlegend verändern. Ihr Lösungsansatz besteht in zirkulären Verfahren der Kreislaufwirtschaft: In der Kreislauffabrik werden gebrauchte Produkte möglichst automatisiert so aufgearbeitet, dass sie als Neuprodukte die Fabrik verlassen. Diese Arbeit steht im Fokus des neuen Sonderforschungsbereichs (SFB) 1574 „Kreislauffabrik für das ewige Produkt“ am KIT, den die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) mit rund 11 Millionen Euro fördert.
Insbesondere produzierende Unternehmen stehen vor der Herausforderung, zirkuläre Ansätze wirtschaftlich in Großserie zu gestalten. Heute finden diese meist noch in Kleinserien mit einem hohen Anteil an manuellen Arbeitsschritten an Niedriglohnstandorten statt. So beträgt der Anteil des recycelten und wieder in die Wirtschaft eingespeisten Materials am gesamten Materialeinsatz in Europa im Jahr 2022 beispielsweise erst 7,2 Prozent (siehe: www.circularity-gap.world/2023). „Als Gesellschaft können wir die von uns nicht mehr benötigten Produkte nicht immer weiter einfach nur entsorgen. Um unsere Ressourcen langfristig nutzen zu können, müssen wir konsequent in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen, um im besten Fall Produkte beziehungsweise deren Komponenten ewig nutzen zu können. Entsprechende zirkuläre Wirtschaftsansätze stehen im Fokus des neuen SFB, der am KIT die Kompetenzen der Forschenden aus Maschinenbau, Informatik sowie Elektrotechnik und Informationstechnik zusammenführt“, sagt Professor Oliver Kraft, in Vertretung des Präsidenten des KIT.
Vision des ewigen innovativen Produkts
Bislang gilt das Remanufacturing, also das Aufarbeiten gebrauchter Produkte, als Verfahren mit dem höchsten Standard in Bezug auf Qualität und Garantie der aufgearbeiteten Produkte. „Es ist das einzige zirkuläre Verfahren, das in diesen Punkten mit einem Neuprodukt konkurrieren kann. Die Vision des SFB ‚Kreislauffabrik‘ geht jedoch weit darüber hinaus. Sie besteht darin, eine integrierte lineare und zirkuläre Produktion von Neuprodukten mit individuellem Aufarbeitungsanteil in industriellem Maßstab möglich zu machen“, so Professorin Gisela Lanza, Leiterin des wbk Institut für Produktionstechnik des KIT und Sprecherin des SFB.
Die Kreislauffabrik soll gebrauchte Produkte in aktuelle Produktgenerationen überführen, um so der Vision des ewigen innovativen Produkts näherzukommen. Auch wenn eine „ewige“ Nutzung gebrauchter Produktsubstanz praktisch nicht realisierbar erscheint, soll die Vision des ewigen innovativen Produkts eingeführt werden. Vergleichbar, so Lanza, sei dies mit dem Nordstern, der den Idealzustand darstellt und auf den alles ausgerichtet werden soll.
„Der Sonderforschungsbereich 1574 markiert einen Eckpfeiler in unserem Forschungsprogramm für das nächste Jahrzehnt am wbk Institut für Produktionstechnik. Unsere Grundlagenforschung bildet die Basis für den Wandel der Wirtschaft von linearen zu zirkulären Modellen und der Befähigung einer Kreislauffabrik für das ewige, innovative Produkt“, erläutert Lanza. Auf dieser Basis möchte sie mit ihrem Team zahlreiche anwendungsnahe Verbundprojekte mit der Industrie starten, die den Weg für eine nachhaltige und innovative Zukunft bereiten.

Aufarbeitung von Metallkomponenten, startet das Team des wbk Instituts für
Produktionstechnik beim SFB durch. (Foto: Beckhoff)

der vom Menschen lernenden Produktionstechnik. (Foto: wbk, KIT)
Themenfelder und Projektbereiche
Um die noch unbekannten Vorgänge und Mechanismen zu erforschen, beschäftigt sich das SFB-Team mit wissenschaftlichen Fragen aus Produktionstechnik, Produktentwicklung und Werkstofftechnik, Arbeitswissenschaft, Robotik, Informatik und Wissensmodellierung. Zentrale Fragestellungen sind: Wie lassen sich aus unikalen Gebrauchtprodukten Neuprodukte generieren? Wie wird ihre Funktionalität im zweiten Lebenszyklus gewährleistet? Wie können Menschen komplexe Problemlösungsstrategien erlernen und wie werden diese Strategien auf automatisierte Produktionstechnik übertragen? Wie lässt sich dies in einem wandelbaren, autonomen Produktionssystem wirtschaftlich umsetzen, um zirkuläre Produktion in Großserie am Hochlohnstandort zu ermöglichen? Wie lassen sich Daten und Informationen nutzen, um den Prozess weiter zu verbessern?
Das SFB-Vorhaben ist in drei Projektbereiche gegliedert: Projektbereich A erforscht die Planung und Steuerung der Kreislauffabrik, um den maximalen Werterhalt von unikalen Gebrauchtprodukten für den Primärmarkt zu erreichen, Projektbereich B entwirft Messstrategien zur Erfassung, Modellierung und Bewertung des individuellen Produktzustands sowie zur Erfassung und Interpretation der menschlichen Prozessausführung und Projektbereich C erschafft ein voll modulares Produktionssystem, das eine fortlaufende Adaption auf immer neue Produktinstanzen ermöglicht. Der Aufbau der Kreislauffabrik im Labormaßstab ist in der ersten Förderperiode geplant. Die DFG fördert das Projekt vom 1. April 2024 bis zum 31. Dezember 2027 mit rund 11 Millionen Euro.
Beteiligte Forschungseinrichtungen
Karlsruher Institut für Technologie:
- Institut für Angewandte Materialien: Dr. Stefan Dietrich, Prof. Volker Schulze
- Institut für Anthropomatik und Robotik: Prof. Tamim Asfour, Prof. Jürgen Beyerer, Prof. Gerhard Neumann, Prof. Rainer Stiefelhagen
- Institut für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation: Prof. Barbara Deml
- Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme: Prof. Kai Furmans
- Institut für Industrielle Informationstechnik: Prof. Michael Heizmann
- Institut für Nanotechnologie: Dr. Michael Selzer
- Institut für Produktentwicklung: Prof. Albert Albers, Prof. Tobias Düser, Dr. Patric Grauberger, Prof. Sven Matthiesen
- Institut für Produktionstechnik: Prof. Jürgen Fleischer, Prof. Gisela Lanza, Prof. Volker Schulze, Prof. Frederik Zanger
Fraunhofer-Gesellschaft:
- Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung: Prof. Jürgen Beyerer, Dr. Julius Pfrommer
Hochschule Aalen – Technik und Wirtschaft:
- Prof. Nicole Stricker
Universität Stuttgart:
- Institut für Künstliche Intelligenz: Jun.-Prof. Alina Roitberg, Prof. Steffen Staab
Weitere Informationen zum Sonderforschungsbereich
Weitere Informationen: https://www.wbk.kit.edu


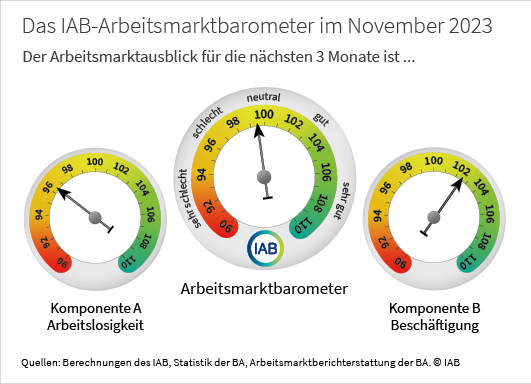
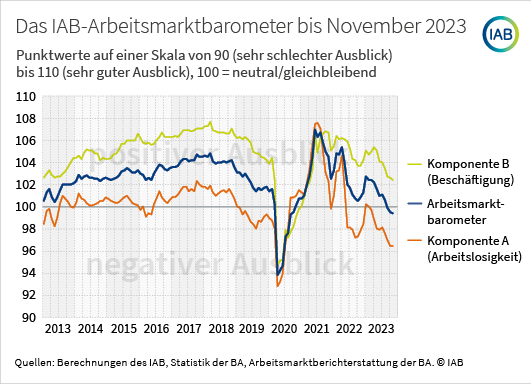




 Die perfekte Gelegenheit also für Lite&Fog, ihre Systeme einer interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren. Das junge Unternehmen bietet mit seinen skalierbaren Growth-Chambers eine ideale Wachstumsumgebung für nahezu alle Nutzpflanzen. Diese werden unter streng kontrollierten Bedingungen ohne Schädlingsbekämpfungsmittel oder andere Zusätze zu perfekter Reife herangezogen. Nährstoffe werden hierbei gemeinsam mit dem Wasser vernebelt und können so von den Pflanzen direkt an der Wurzel aufgenommen werden.
Die perfekte Gelegenheit also für Lite&Fog, ihre Systeme einer interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren. Das junge Unternehmen bietet mit seinen skalierbaren Growth-Chambers eine ideale Wachstumsumgebung für nahezu alle Nutzpflanzen. Diese werden unter streng kontrollierten Bedingungen ohne Schädlingsbekämpfungsmittel oder andere Zusätze zu perfekter Reife herangezogen. Nährstoffe werden hierbei gemeinsam mit dem Wasser vernebelt und können so von den Pflanzen direkt an der Wurzel aufgenommen werden.
 Marie-Christine Ostermann, Präsidentin der Familienunternehmer:
Marie-Christine Ostermann, Präsidentin der Familienunternehmer:  Über den Autor:
Über den Autor: