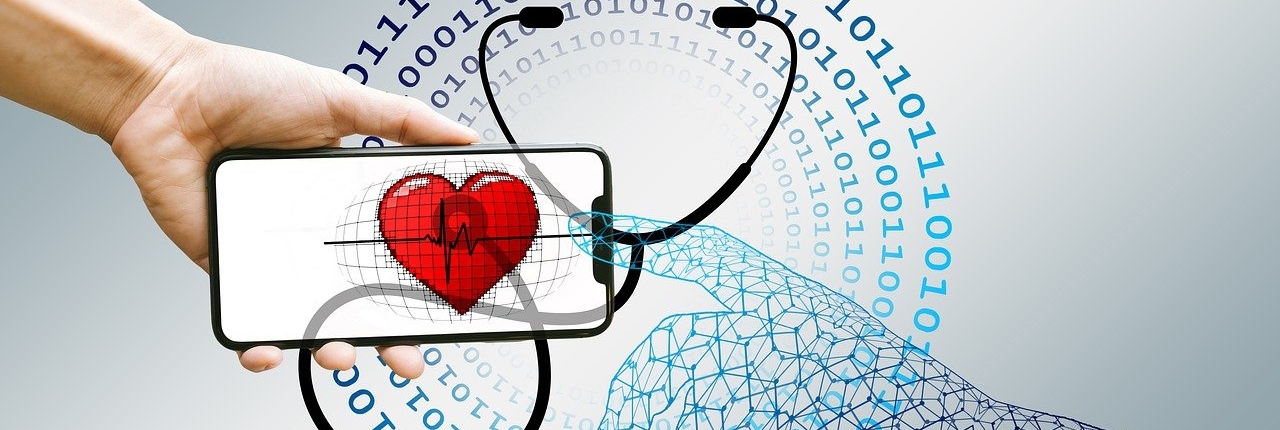Kai Grunwitz, CEO von NTT Germany kommentiert:
Digitale Patientenakte: Gut gemeint ist nicht immer auch gut gemacht
Die elektronische Patientenakte soll endlich Fahrt aufnehmen. Gut so – denn die bisherigen Abläufe passen so gar nicht in unsere Zeit. Fragebögen zu vorherigen Behandlungen, Allergien oder Medikamenten muss man als Patient handschriftlich ausfüllen. Ultraschallbilder bekommt man auf CD-ROM in die Hand gedrückt, um sie dann im Krankenhaus vorzulegen. Die Klinik wiederum schickt für die Anschlussbehandlung ihre Befunde per Fax an die Arztpraxis, wo sie für die eigene Dokumentation einscannt werden. Effizient? Definitiv nicht! Und sogar richtig gefährlich, wenn man als Notfall ins Krankenhaus kommt. Die Ärzte haben keine Infos, ob jemand auf Narkosemittel allergisch reagiert oder welche Medikamente er nimmt. Sie müssen zunächst zahlreiche Untersuchungen machen, obwohl vielleicht jede Minute zählt. „Brieftaubenniveau“ – so beschrieb der Intensiv- und Notfallmediziner Christian Karagiannidis, Mitglied des Expertenrats der deutschen Bundesregierung, einmal ziemlich treffend den Zustand im deutschen Gesundheitswesen.
Nun gibt es die elektronische Patientenakte, bekannt als ePa, in Deutschland eigentlich schon seit Januar 2021 – aber nicht einmal ein Prozent der rund 73 Millionen gesetzlich Versicherten haben bislang eine. Erstens, weil kaum einer davon weiß, und zweitens, weil man selbst aktiv werden muss. Das Anmeldeverfahren ist allerdings kompliziert und die dafür notwendigen Apps der jeweiligen Krankenkasse oftmals nicht ausgereift. Was als freiwilliges Angebot nicht funktioniert hat, soll jetzt also verpflichtend bis Ende 2024 eingeführt werden. Jeder, der nicht ausdrücklich widerspricht, ist automatisch dabei. Nun gelten die Deutschen gegenüber neuen technischen Erfindungen per se als besonders kritisch – zu Recht, wenn es um sensible, persönliche Daten geht. Denn welche Informationen wären intimer als die über die eigene Gesundheit? Deswegen sollten Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes ernst genommen und ausgeräumt werden. Darauf sollte sich Karl Lauterbach konzentrieren, indem er seine Opt-out-Regelung eng auf die DSGVO abstimmt und nicht dem Bundesdatenschutzbeauftragten das Vetorecht entzieht, wie anscheinend passiert.
„Nur wenn Datenschutz und Datensicherheit glaubhaft gewährleistet werden, lässt sich bei den Verbrauchern das notwendige Vertrauen schaffen.“
Brisant ist auch ein anderer Aspekt von Lauterbachs Plänen: Neben den Daten aus der elektronischen Patientenakte, deren Nutzung die Bürger widersprechen können, sollen offenbar weitere Gesundheitsdaten für die forschende Industrie zur Verfügung gestellt werden – ohne, dass man ein Veto-Recht hat. Das betrifft die Abrechnungsdaten der gesetzlichen Krankenkassen, die zentral im Forschungsdatenzentrum gespeichert werden. Bis zu 30 Jahre gesammelte Versicherungsdaten zu Diagnosen, Operationen und Medikamenten lassen selbst in anonymisierter und pseudonymisierter Form durchaus Rückschlüsse auf die jeweilige Person zu.
Der gläserne Patient kann und darf nicht im Interesse der Politik sein. Nur wenn Datenschutz und Datensicherheit glaubhaft gewährleistet werden, lässt sich bei den Verbrauchern das notwendige Vertrauen schaffen. Wobei man ehrlich sagen muss, dass wir – und da nehme ich mich nicht aus – ansonsten mit sensiblen Gesundheitsinformationen recht großzügig umgehen. Das Fitnessarmband zählt Schritte und Kalorien, die Smartwatch kontrolliert Puls und Herzfrequenz, Apps sammeln fleißig alle Ergebnisse ein. Diese Daten stellen wir amerikanischen Konzernen bereitwillig zur Verfügung, ohne nach dem Datenschutz zu fragen.
Es gibt noch ein weiteres Problem, das insbesondere die ältere Generation betrifft. Sie benutzen meistens weder Smartphone noch Tablet. Damit bleibt ihnen der vollumfängliche Zugang zur elektronischen Patientenakte verwehrt, denn dies funktioniert mehr oder weniger nur über eine App. Dabei wäre gerade für ältere Menschen ein zentraler Ort, an dem Gesundheitsdaten gebündelt liegen, sinnvoll: Die Medikation würde sich besser koordinieren lassen und Untersuchungsergebnisse wären schneller zu Hand. Auch hier ist also ein wichtiger Punkt ungeklärt. Und wer überträgt eigentlich die bisherigen Behandlungsdaten? Eine Möglichkeit wären die Hausärzte. Die winken aber ab, die Zeit dafür ist schlichtweg nicht da. Viele Praxen sind zudem für die E-Akte Stand heute technisch gar nicht gerüstet. Es fehlt an den entsprechenden Verbindungsgeräten zur geschützten Datenautobahn des Gesundheitswesens, damit eine komfortable und DSGVO-konforme Kommunikation zwischen allen Akteuren überhaupt möglich ist.
Damit wir uns nicht falsch verstehen – wenn es nach mir geht, kann die digitale Patientenakte nicht schnell genug kommen. Eine digitale Patientenakte, die technisch sicher sowie intuitiv bedienbar ist und bei der jeder Zugriffsrechte und Datenspenden ganz nach seinen Vorstellungen festlegen kann. Wir haben schon zu viele Jahre bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens verschlafen.